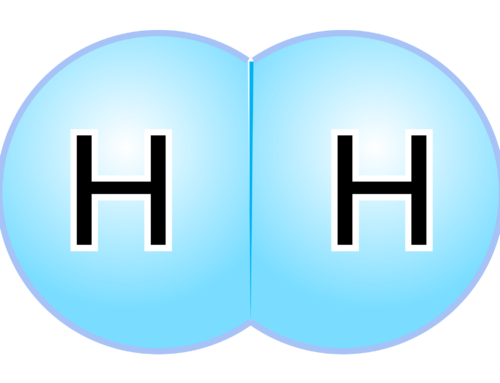Bei Heide und Udo Ernst Simonis: Wer schüttelt die Deutschen?
Er – Professor im Ruhestand. Internationale Umweltpolitik ist sein Thema, mit dem er auch im Freitag präsent ist, in diesen Wochen der Fluten, des Feuers und der Hurricans ganz besonders. Sie – bis vor sechs Monaten Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, einzige Frau je hierzulande auf einem solchen Posten, zwölf Jahre lang. Eine erfolgreiche Karriere, am Ende gewürzt mit Bitterkeiten.
Den Freitag kennt sie, weil er „hier jede Woche zelebriert wird, von meinem Mann, nicht so sehr von mir. Und manchmal denke ich: Das darf doch nicht wahr sein, haben die immer noch die alten Begriffe drauf.“ Worauf er gelassen, mit einer gemütlichen, tiefen Stimme kontert: „Manchmal bin ich froh, dass es diese Begriffe noch gibt und denke dann, gut getroffen.“
Wir sitzen in ihrer Kieler Wohnung, die zu einem Stadtpark hin drei ineinander gehende Zimmer mit Riesenfenstern hat, Erker, Stuck, ein Flur bis hinten zum Garten. Licht, schöne Kelims, Skulpturen, Bücher, an den Wänden Aquarelle und Zeichnungen. Kiel sei vor allem durch die Lage an der Förde interessant, dämpft Heide Simonis mögliche Erwartungen. Die Stadt war im Krieg zu 85 Prozent zerstört und habe sich davon nur schwer erholt. Später zeigt uns Udo Ernst Simonis auch noch die Bausünden, Abrisse von Straßenzügen und Betonklötze im Zentrum, eine zweite Stadtzerstörung nach dem Krieg.
Wie mögen sich die beiden gegenseitig beeinflusst haben? Er bewegt sich auf dem globalen Feld, sie in der Alltagspolitik. Er ist mit den großen Themen befasst, muss allerdings ungewollt den geringen Einfluss eines Wissenschaftlers hinnehmen. Sie hatte sehr direkte Macht, stieß aber ständig an Haushaltsgrenzen. Er erinnert sich lachend an einen alten Spruch: „Meine Frau entscheidet zu Hause alles, und ich darf entscheiden, ob China in die UNO kommt.“ Mit „Zu Hause“ ist in diesem Fall nicht die Wohnung gemeint, sondern das Land zwischen Ostsee und Watt. In ihrem Buch Unter Männern hat sie den erschrockenen Ausruf eines Mitbürgers zitiert, mit Ironie, aber wohl auch mit verborgenem Wohlgefallen: „Unser schönes Schleswig-Holstein in der Hand einer einzigen Frau?“
Aber nun antwortet sie ganz ernst: „Ich habe ihn nie beeinflusst, eher umgekehrt. Das Thema Wasser hatte er Jahre lang drauf, bis mir klar wurde, mein Gott, wir sind hier mit dem Wasser geboren, daraus kann man doch auch etwas machen. Es war ein wirklicher Übersprung von dem, was er wissenschaftlich oder in den Gremien der Vereinten Nationen machte und was ich hier umsetzen konnte. Trotzdem war für ihn die Alltagspolitik eher ein Rumgeknödel.“
Er lacht und widerspricht: Wir sollten nicht meinen, ihn würden die kleinen Dinge im Leben nicht interessieren. „Doch um die Globalisierung der Politik muss sich auch jemand kümmern. Schließlich gibt es da keine Regierung, bis vor kurzem nicht einmal ein Gericht. Da ist also viel zu tun.“
Man könne im deutschen Alltag schon frustriert werden, gibt er zu. „Vielleicht habe ich mich deshalb den globalen Fragen zugewandt, die doch viel gravierender sind. Wenn ich diesen elenden deutschen Wahlkampf sehe – angesichts dessen, was in der Welt wirklich los ist, kann ich nur den Kopf schütteln. Keine der führenden Parteien hat die Ängste in der Gesellschaft im Sinne eines neuen Zukunftsmodells verstanden. Das aber wird gebraucht. Da wurde mit Angst vor Hartz IV und Angst vor der Merkelschen Kälte operiert. Aus beiden Ängsten sind zwei relativ kleine Parteien geworden – keine über 40 Prozent.“
Wir sind nach Kiel gekommen, um ein Gespräch zu führen, das über die Misere der derzeitigen Politik hinausgeht – mit einer Insiderin rot-grüner Politik, die seit dem Frühjahr in Distanz zu ihrer Partei geraten ist, verletzt wurde, bisher keine neuen Angebote von den Genossen erhielt.
Bilanziert man sieben Jahre Rot-Grün, kann man den Ausbau der erneuerbaren Energien oder die Distanz zum Irak-Krieg anerkennen. Aber war nicht die Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik miserabel? Der Kernbereich der Innenpolitik schlecht bis zum Versagen? Zuerst Steuergeschenke an Unternehmen, dann Sozialabbau mit der Agenda 2010? Wäre nicht eine völlig andere Politik für Sozialdemokraten möglich gewesen?
Heide Simonis unterbricht: „Die Deutschen sind grundsätzlich zu spät dran. Wir haben ja erlebt, dass alle europäischen Länder solche Prozesse durchgemacht haben. Auch in Schweden hat es gekracht, 1991, 92, 93. Wir dagegen haben gezögert, weil durch die Übertragung der DDR-Sparguthaben in DM eine Nachfragewelle von zwei Jahren über uns kam und die Illusion erzeugte, die Deutschen sind mal wieder besser dran als alle anderen.“
Aus ihrer Perspektive ist nicht eine falsche Orientierung, sondern eine Dynamik des Versagens schuld am jetzigen Zustand: handwerkliche Fehler, zu spät eingeleitete Reformen, nicht durchdacht, schön geredet, die Unfähigkeit der Bundesagentur für Arbeit und der Geburtsfehler der Hartz-Reformen, dass nicht alles den Kommunen übergeben wurde – wie in Skandinavien. Diese Fehler hätten das große Gefühl des Nicht-Mehr-Mitgehen-Wollens bei den Bürgern hervorgerufen. „Der Widerstand war erbittert und hat uns eine Wahl nach der anderen gekostet.“ Aber, so sagt sie, wie zum eigenen Trost: „Im Leben ist es so, dass es auch wieder zurückschwingt. Nur ist jetzt die SPD auf kleinerer Flamme angelangt und hat nicht mehr die großen Möglichkeiten.“
Ist das nicht eigenes Verschulden? „Ja, wir haben Geschenke gemacht, um die Unternehmen kapitalkräftig zu halten und gesagt, jetzt kommt ihr im Gegenzug mit Arbeitsplätzen rüber“, räumt sie ein. „Die haben einen Teufel getan. Sie bauen schon wieder ab, Siemens, Mercedes, VW, immer gleich im Tausenderpack, es ist grauenvoll. Ich glaube, die SPD und der Kanzler haben zu lange auf die Dankbarkeit der Unternehmer gesetzt. Mit Dankbarkeit hat man in der Politik noch nie etwas erreicht.“
Wie konnte man Entgegenkommen denn erwarten, fragen wir wieder. Und sie sagt mit einer gewissen Müdigkeit: „Ich glaube auch nicht mehr, dass die Unternehmen uns etwas schenken. Wir werden ganz andere Ansätze verfolgen müssen. Gezielt Investitionsprojekte unterstützen, mehr öffentliche Arbeitsplätze anbieten, bessere Fortbildung – das sind Elemente, die in die Agenda 2010 eingebaut werden müssen.“ Die ganze Agenda zu streichen, das gehört nicht in ihr Denken.
„Heide“ – fünf Buchstaben waren im Frühjahr auf den Wahlplakaten zu lesen, sonst nichts. Sie lächelt: „Einen Zusatz brauchte man auch nicht. Wir hatten aber auch ein Wahlprogramm, das es in sich hatte: Gemeinschaftsschule, alternative Energien, neues Steuerkonzept. Die Wahlkämpfe werden immer amerikanischer, die Spitzenfiguren stehen im Vordergrund. Die SPD hat mich in geheimer Wahl mit 100 Prozent zur Spitzenkandidatin bestimmt. Es ist auch schön, so identifiziert zu werden, selbst wenn es eine Last wird, viele Erwartungen nicht erfüllen zu können. Jetzt bei Hartz IV, wenn die Leute einem zeigen, dass sie nichts mehr im Portmonee haben, da kann man sich schon mit Wut fragen: Was habe ich damit zu tun, ich habe es nicht gemacht. Aber wir sind eine Partei, also muss man auch dazu stehen.“
Mehr Skandinavien wagen – das war ein Leitmotiv im Wahlkampf der SPD in Schleswig-Holstein. Udo Ernst Simonis findet, das könnte jetzt auch für die Koalitionsbildung in Berlin gelten: „In Schweden und Dänemark hätte man mit dem Wahlergebnis gut leben können und Rot-Grün keineswegs aufgegeben. Eine Minderheitsregierung ist dort das Übliche. Die Stimmen für Schröder als Kanzler wären sicher zusammengekommen. Anschließend holt man sich die Mehrheiten von Fall zu Fall.“ Aber das wäre undeutsch, soweit sind wir noch nicht, bemerkt sie bitter.
Und nun spricht sie über ihr eigenes Beispiel: „Wir hatten hier ja eine Minderheitsregierung vorgeschlagen, bei Duldung durch den SSW*. Es gab bisher erst eine, in Sachsen-Anhalt, es wäre interessant gewesen, diese Erfahrung zu machen. Da bin ich aus den eigenen Reihen torpediert worden: Um Gottes Willen, eine Minderheitsregierung.“
Eine Stimme der Enthaltung aus dem eigenen Lager brachte sie im entscheidenden Moment der Wahl zur Ministerpräsidentin zu Fall. War das Ausdruck der Angst vor der Minderheitenposition, fragen wir überrascht. „Nein, das doch nicht“, korrigiert sie den Eindruck. „Es war eine Nachricht an mich. Unser Vorgehen war ja vorher in den Parteigremien einstimmig beschlossen worden.“ Es war Verrat. Sie könne es nicht anders wahrnehmen, und schmerzhaft sei, dass sie in der SPD Schleswig-Holsteins immer überzeugt waren, sie wären anders als die anderen. „Wir sind gegen AKWs gewesen, wir sind als erste in die DDR gefahren, als Herbert Wehner noch ein Reiseverbot ausgesprochen hatte – eine dickköpfige, aber ehrliche Partei. Offenbar aber können einzelne in der Partei genauso gemein sein wie andere – und einem das Messer in den Rücken stoßen.“
Und nun habe Schröder seine Partei schwer ins Wanken gebracht, als er ohne Absprache die Neuwahlen verkündete, erinnern wir. Was sagt sie dazu, die Amt und Würden hinter sich gelassen hat und um eine Erfahrung reicher ist? Neuwahlen hätte sie nicht angesetzt an Schröders Stelle, antwortet sie milde. Es gäbe ja einige positive Zahlen in der Wirtschaft, er hätte alles neu sortieren können. Warum hat er es dann getan? Da kommt eine überraschende Erklärung: „Es gibt Leute, die sagen, er hätte Angst gehabt, das Schicksal zu erleiden, das ich hatte.“ Diese Leute meinen, Schröder habe befürchtet, ihm werde alles unter den Händen zerbröseln, wenn ihm nur einmal die Mehrheit fehlen sollte.
Wie aber kann man mit der Verlogenheit des Wahlkampfs umgehen, den Schröder mit linken Argumenten führte, die nichts mit seiner Regierungspolitik zu tun hatten? Und mit dem abstoßenden Machtpoker danach? Sie will ihn und die SPD-Politik doch rechtfertigen, sieht Unsicherheit über die nächsten Schritte, vor allem riesigen Diskussionsbedarf, auch beim Ost-West-Problem, bei den Transferzahlungen, bei der notwendigen Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, ohne dass die Untersten das allein zahlen.
Eine wirkliche Debatte jedoch sei in Deutschland im Moment unmöglich, das sei ihre Erkenntnis, sagt Heide Simonis: „Weder über gesellschaftliche Ziele im allgemeinen noch darüber, wie viel Staat wir haben wollen. Auch nicht über die juristischen Verfahren, die aus dem Ruder laufen, über die Zwänge, Aktenberge durchzuackern, nur um ein Gebiet unter Naturschutz zu stellen oder eine Straßentrasse festzulegen. Die Folge ist, die Deutschen reden in Schlagworten und gruseln sich zu Tode. Und erkennen ihre Chancen nicht. Da
könnte ich sie manchmal schütteln.“ Dabei sei Deutschland doch eigentlich gut aufgestellt und die Depression nur in den Köpfen, beobachte das Ausland. „Wir aber knabbern an den Fingernägeln.“
Muss man immer wieder die Mentalität der Deutschen für die Stimmungslage verantwortlich machen? Wir finden, die Bundesregierung selbst habe die Angst um den Standort geschürt, um die Politik des Sozialabbaus durchzusetzen. Dieses Argument verblüfft beide. „Die Konservativen waren es doch, die ihren ganzen Wahlkampf darauf aufgebaut hatten, dem Land gehe es so schlecht, dass ein Wechsel fällig sei“, sagt er. Nein, eine Absicht, den Leuten Angst zu machen, habe es nicht gegeben, das steht auch für sie außer Zweifel. Nur habe man eben nicht wirklich nach Alternativen zur Sparpolitik gesucht.
Ist die Linkspartei für sie ein Diskussionspartner, um von den Mustern des Kürzens und Streichens weg zu kommen? Da wird sie scharf: „Definitiv nein, solange Oskar Lafontaine dabei ist.“ Sie wirft ihm seine opulenten Honorare vor und nennt sein „Lied vom Teilen“ unehrlich. Der Affekt gegen den Abtrünnigen ist sofort da. Wenn einst die Linkspartei ohne Lafontaine da stehen sollte, müsse man sie genauer betrachten, das lässt sie als Erwägung gern zu, doch seltsam herablassend nennt sie die Linke „eine Partei der Unzufriedenen, Unglücklichen und Gescheiterten“. Da widerspricht ihr Mann: „Es war der historische Fehler der SPD, dass sie seit der Wiedervereinigung nicht auf die PDS zugegangen ist, es auch jetzt noch nicht tut. Es ist höchste Zeit, dass man das, was links von der Mitte in diesem Land möglich ist, auch organisatorisch zusammenführt. Aber ich fürchte, ich werde das nicht mehr erleben.“ Und halb resigniert, halb zornig hängt er den Satz an: „Nach 15 Jahren immer noch diese Spaltung im Land, das ist doch eigentlich unerträglich.“
Heide Simonis sucht nach neuen Aufgaben für sich. Die eigene Partei bietet ihr keine an, verschenkt ihre Kompetenzen, darunter ihre Erfahrungen mit Institutionen im Ostseeraum. „Jetzt sehe ich mich Hals über Kopf bei UNICEF engagieren. Das ist aber etwas, worauf ich mich gern stürze.“ Die Männer der Partei, auch manche gescheiterten Ministerpräsidenten, werden unter sich bleiben.
* Südschleswigscher Wählerverband