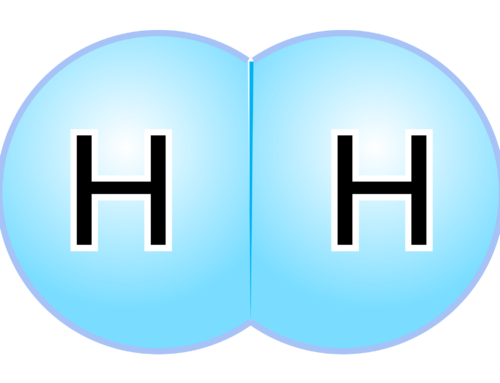VIELLEICHT DIE LETZTE CHANCE Ein sauberes Konjunkturprogramm in Permanenz würde sich ergeben, wenn man kompromisslos und endgültig die fossile Ära verabschiedet
Im Dorf Varchentin, nicht weit von der Müritz, mitten in der mecklenburgischen Landschaft, ist sie schon da, die Revolution, die den Osten Deutschlands vielleicht doch noch retten könnte. An der Spitze steht Andreas Tornow, Landwirt mit 1.600 Hektar unterm Pflug, von mächtiger Gestalt wie Obelix und scharfsinnig wie Asterix. In seinem Hauptquartier, dem früheren Pfarrhaus, sitzen wir am großen Tisch in der guten Stube, wo einst der protestantische Geist mit seiner Kinderschar zu Abend saß. „Vor zehn Jahren“, erzählt Tornow, „standen wir vor einer einfachen Frage. Sehen wir weiter zu, wie unsere Dörfer allmählich sterben oder besinnen wir uns darauf, dass wir alles haben und alles können? Allein aus Varchentin mit seinen 200 Seelen fließen jährlich 300.000 Mark an die Ölscheichs und Stromkonzerne – das war unsere erste Rechnung und Rapsöl unsere erste Antwort. Alles selbst machen, was man selbst machen kann, dabei sind wir dann geblieben, Schritt für Schritt.“
Der Zaubertrank vom eigenen Acker, in der Hofmühle selbst gepresst, speist heute Tornows gesamten Maschinenpark und die Traktoren der Umgebung. Vor allem aber war das „Projekt Dieselersatz“ die Initialzündung – für Blockheizkraftwerke, die Strom und Wärme liefern, für einen eigenen kleinen Schlachthof, für ein Dorfrestaurant, für die Holzverwertung, für Arbeit und Einkommen, für die Überzeugung, dass regionale Kreisläufe funktionieren können. „Das ist kein Kampf gegen die Ökonomie, sondern mit ihr“, begründet Tornow sein Konzept, „unsere kleine Ölmühle hat Presskosten von 35 Euro je Tonne, bei der riesigen Anlage in Hamburg sind es nur fünf. Aber der Transport der Rohstoffe kostet dort 20 und der Weg des fertigen Produkts zum Kunden noch mal 20 Euro pro Tonne. Wenn man dann noch deren Verwaltungs- und Vertriebsaufwand hinzurechnet, sind wir eindeutig besser. Denn bei uns geht der Raps vom Feld direkt in die Presse und von dort direkt in den Tank.“
Ökologischer als alle Grünen, radikaler als alle Linken, zeigt Andreas Tornow, der scharf kalkulierende und gerade deshalb gemeinwohlorientierte Agrarunternehmer, dass nachhaltiges Wirtschaften möglich ist. Aber ist das ein Modell? Vielleicht für die ländlichen Problemzonen, aber doch nicht für Ostdeutschland insgesamt – dieser Einwand liegt nahe und führt dennoch in die Irre. Denn vor den Fragen, die in Varchentin gestellt worden sind, stehen nahezu alle Regionen östlich der Elbe. Was können wir selbst, und wie sollen künftig nachhaltig existenzfähige Wirtschaftstrukturen entstehen, wenn dieses Ziel schon in der Vergangenheit trotz beträchtlicher öffentlicher Mittel für Investitions- und Infrastrukturförderung nicht erreicht werden konnte? Wie sollen anhaltende Schrumpfungsprozesse bewältigt werden, wenn gleichzeitig die von außen bezogenen Transfers zu sinken beginnen?
Aus den multiplen Problemlagen mit überdurchschnittlichen Steigerungsraten der regionalen Wirtschaft „herauszuwachsen“ war der ursprüngliche, längst gescheiterte Ansatz. Nicht offiziell, aber faktisch wurde von der Bundespolitik – unabhängig von der Regierungskonstellation – der Versuch aufgegeben, die ostdeutsche Misere als Ganzes zu lösen. Unter der Hand hat sich die anfangs geltende Förderphilosophie ins Gegenteil verkehrt: nicht die Schwächen beseitigen, sondern die Stärken stärken, nicht flächendeckend, sondern punktuell fördern, nicht die Gießkanne für die Landschaften, sondern der Bonus für die industriellen Leuchttürme.
Gebannt auf die knapper werdenden Mittel starrend, wird der einzige Kandidat nicht gesehen, der in hinreichender Breite für eine Trendwende nicht nur in den Dörfern Mecklenburgs sorgen könnte – der ökologisch zwingende, zunehmend aber auch ökonomisch gebotene und für die internationale Arbeitsteilung fundamentale Wechsel der Energie- und Ressourcenbasis. Der Abschied vom Erdöl und später auch vom Erdgas wird vermutlich zu einem besonderen Engpass bei den universell einsetzbaren regenerativen Energieträgern führen. Im Unterschied zu Solar- und Windenergieanlagen kann die Landwirtschaft von vornherein sowohl grundlastfähige als auch speicherbare und transportfähige Energieträger bereit stellen. Für den Verkehrssektor ist Bioenergie bislang sogar der einzige Ersatz, der in nennenswertem Umfang eingesetzt wird, und Erdöl substituierende Grundstoffe für die chemische Industrie können bislang überhaupt nur von der Landwirtschaft produziert werden.
Anders als bei den beiden bisher dominanten Trends weltwirtschaftlicher Entwicklung – der globalen Streuung von Fertigungsstätten nach den Gesichtspunkten der Lohnhöhe und der Marktnähe sowie der Konzentration von anspruchsvollen technischen Kompetenzen in urbanen Clustern – geraten Räume mit einer hochproduktiven und großflächigen Landwirtschaft erstmals nicht ins Abseits, sondern ins Zentrum der ökonomischen Aufmerksamkeit. Der Zugriff auf Bioressourcen und Flächenreserven wird zu einer strategischen Angelegenheit.
Dieser Rückenwind verwandelt sich allerdings nicht automatisch in Jobs und Einkommen. Denkbar ist auch, dass Ostdeutschland zum Objekt einer „passiven Ökologisierung“ wird. Das wäre dann der Fall, wenn sich bei der Landwirtschaft nur der Nutzungszweck ihrer Produkte ändert (Energieproduktion statt Nahrungsproduktion), sie aber ausschließlich Rohstofflieferant bleibt, oder wenn Landkreise nur zum Standort von Energieanlagen werden und nur marginal an den wirtschaftlichen Effekten teilhaben. Ein Beispiel für dieses Extrem ist die Windstromerzeugung im Landkreis Prignitz in Brandenburg. Dort sind heute cirka 500 Megawatt Windenergieleistung installiert – rund zwei Prozent der gesamten deutschen Kapazität. Aber fast alle Leistungen kamen von außen. Landkreise, deren Ökobilanz im Strombereich exzellent ist, die aber ökonomisch fast nichts davon haben, sind offensichtlich nicht optimal.
Je aktiver die Kommunen selbst sind, je mehr sie die Energiefragen selbst in die Hand nehmen, desto geringer ist die Gefahr einer nur passiven Ökologisierung, und um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich vor Ort die Fähigkeiten und unternehmerischen Leistungsangebote herausbilden. Ein erfolgreiches Beispiel und im Vergleich zur Prignitz das andere Extrem ist die österreichische Gemeinde Güssing. Sie stand Ende der achtziger Jahre vor Problemen, die mit den heutigen in vielen Orten Ostdeutschlands vergleichbar sind: Strukturschwäche, hohe Arbeitslosigkeit, Abwanderung. Damals wurde in Güssing der sehr ehrgeizige und mittlerweile verwirklichte Beschluss gefasst, die Gemeinde vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Aufgrund dieser Initiative sind in 15 Jahren eine stattliche Anzahl von Firmen, knapp 500 Arbeitsplätze und das „Europäische Zentrum für Erneuerbare Energien“ entstanden. Nicht in der Dimension, aber in der Qualität des Ansatzes vergleichbar ist das Modell Varchentin.
Grundsätzlich können alle Landkreise in Ostdeutschland zu den Gewinnern der ökologischen Modernisierung werden. Die Erzeugung und den Verbrauch regenerativer Energie zu regionalisieren und zu kommunalisieren, ist im Unterschied zum Wettbewerb um externe Investoren aus beliebigen Branchen kein Konkurrenz-Projekt zwischen den Kommunen. Dass es zugleich Chancen der Re-Industrialisierung gibt, zeigen unter anderem die Biodiesel- und Bioethanolwerke, die in Ostdeutschland gebaut wurden. Mit der in Ansätzen bereits begonnenen „Naturalisierung der chemischen Industrie“ rücken künftig biogene Grund-, Werk-, Kunst- und Baustoffe in den Blickpunkt. Da unveredelte Biomasse hohe relative Transportkosten verursacht, wird der Standortfaktor „Ressourcennähe“ wichtiger.
Die Energie- und Ressourcenwende, die bereits begonnen hat und bis zur regionalen Vollversorgung mit erneuerbaren Energien und sogar echten Exportsituationen weiter vollzogen werden kann, bietet Vorteile, die in kaum einer anderen Branche oder einem anderen Politikfeld zu finden sind. Eigenständiges Handeln von Kommunen, Stadtwerken, Bürgern und Unternehmen ist möglich. Man muss nicht auf Konzerne und Heuschrecken warten. Im Energiesektor ist eine Strategie der „Importsubstitution“ technologisch möglich und ökonomisch sinnvoll. Und das Jahr 2019, das Ende des Solidarpakts II, würde nicht mehr wie ein Damoklesschwert über Ostdeutschland hängen, wenn der energetische Aufschwung gelingt. Denn die rund 15 Milliarden Euro, die heute von den Ostbürgern für fremde, schmutzige Energieträger ausgegeben werden, würden vor Ort für neue Jobs, neue Firmen und neue Perspektiven sorgen – ein sauberes Konjunkturprogramm in Permanenz.
Konfliktlos ist dieses Szenario nicht zu haben. Das gegenwärtige Energiesystem ist auf große Unternehmen, große Kraftwerke, große Netze zugeschnitten, und mit der entsprechenden Oligopolmacht ist zu rechnen. Aber „weiter wie bisher“ ist keine Alternative. Das ist nirgends deutlicher als in der Heimat von Andreas Tornow. Mecklenburg-Vorpommern hat große, profitable Agrarunternehmen und gleichzeitig besonders drastische soziale Schieflagen im ländlichen Raum. Im Unterschied zu ihren westdeutschen und europäischen Kollegen sind die Bauern im deutschen Nordosten durchaus mit Farmern in den USA vergleichbar. In dieser zugespitzten Analogie wird allerdings auch deutlich: Die ländliche Gesellschaft, die es im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten nicht gibt, hat in Nordostdeutschland ihre ökonomische Basis verloren, weil fast alles, was nicht zum Kerngeschäft der Pflanzenproduktion zählt, seit 1990 abgeschafft worden ist. Wer auf neue Kreisläufe verzichtet, kann die Zukunft in Kansas besichtigen. Kilometerweit Monokulturen, von Menschen keine Spur.