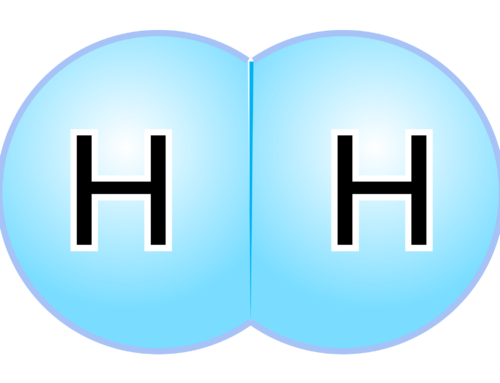Nach dem 60. Jahrestag: Die permanente Verwechslung von Opfern und Tätern findet bei Müntefering ihre Fortsetzung
Ein Regisseur des 60. Jahrestages, wenn es ihn denn gäbe, hätte den Abschluss nicht besser inszenieren können: In Berlin, wo einst Völkermord und totaler Krieg organisiert wurden, blockieren mutige Zeitgenossen den Marsch der Neonazis. Das war keine wohlfeile Beschwörung demokratischer Reife, sondern ein selbstbewusst gesetztes Zeichen, kein Normalisierungstheater, sondern Wirklichkeit. Postwendend allerdings wird selbst dieses wertvolle Zeichen missbraucht, um die große Inszenierung der vergangenen Monate nachträglich zu legitimieren. Ja, wir waren Täter, aber eben auch Opfer, sind schließlich zu Demokraten geworden, hatten 1989 im Osten unsere eigene Revolution und nun mitten in Berlin den für alle Welt sichtbaren Widerstand.
Wir haben nun alles beisammen: die rationale und ausgewogene Auseinandersetzung mit der Geschichte, die Opfer und Täter gleichermaßen würdigt, die Institutionen der Demokratie, ihre Insignien und ihre gelebte Realität. Wir sind so reif, dass wir uns über jene, die noch nicht so weit sind, schon wieder erheben dürfen. »Wie haben Sie in Moskau das Feiertagsgetöse erlebt?« – fragt Steffen Seibert im ZDF seine Korrespondentin. Irgendwann, wenn Horst Köhlers unappetitliche Mischung aus forciertem Neoliberalismus und altbackener Deutschtümelei seine volle Wirkung entfaltet hat, vielleicht zum 70. Jahrestag, wird die Frage lauten: »Wie war´s am Brandenburger Tor beim Holocaust-Getöse?«
Bis dahin bleibt der Umgang mit der Gegenwart entscheidendes Kriterium demokratischer Reife, wahlweise auch des ihr folgenden Stadiums, das man üblicherweise Fäulnis nennt. Inhaltlich ganz anders, aber dem Blick auf die Nazizeit durchaus strukturgleich, werden auch bei den aktuellen Reflexionen über Wirtschaft und Gesellschaft immer wieder Wirkungen und Ursachen verwechselt, Symptome genannt und deren Entstehung verschwiegen. Dass die Belastung der Sozialsysteme – eine Folge hoher Arbeitslosigkeit und verfehlter deutscher Einheit – zur Ursache der Stagnation umgedeutet wird, erleben wir seit Jahren. Dass nur mit sinkenden Gehältern Wachstum zu erzielen ist, gehört zu den Standardsätzen deutscher Logik.
Das neue Kapitel, das Franz Müntefering aufgeschlagen hat, öffnet die Frontlinien, benennt Phänomene, die von Millionen erlebt, aber bislang nur von Außenseitern angesprochen wurden. Allen wahltaktischen Kalkülen zum Trotz ist sein Vorstoß zu begrüßen. Aber seinen Klagen über die Schattenseiten der Profitwirtschaft, seinen Fragen nach der Handlungsfähigkeit des Staates und verdächtig weiten Begriffen fehlt die entscheidende, weil von ihm beeinflussbare Komponente: die Politik der Regierungspartei SPD. Würde Franz Müntefering sich selbst beim Wort nehmen, müsste er zur Aufhebung zentraler Entscheidungen der vergangenen Jahre aufrufen und dabei an erster Stelle die Steuerfreistellung von Veräußerungsgewinnen nennen.
Dieses Weihnachtsgeschenk von 1999 – so großzügig, dass selbst Banken und Versicherungen einige Tage brauchten, um die historische Dimension zu erkennen – war die Initialzündung für den Beteiligungsmarkt und eine Einladung an jene, die man nicht Heuschrecken, sondern Plünderer nennen sollte. Noch verlockender wurden die Beutestücke zwischen Rhein und Elbe mit der drastischen Senkung der effektiven Steuerlast seit 2001 und der gleichzeitigen Beibehaltung eines im internationalen Vergleich extrem liberalen Bilanzrechts. Dass man in der rot-grünen Republik schadlos und unbehelligt mittelständische und sogar große Unternehmen einem kreativen »Restructuring« unterwerfen kann, konnte auf Dauer nicht verborgen bleiben.
Spätestens mit der Agenda 2010 war auch dem letzten Finanzinvestor klar, dass good old Germany in einzigartiger Weise attraktiv geworden ist: oben die Gestaltungsfreiheit, unten der Lohndruck und dazu noch die fortbestehende große Tradition des Rheinischen Kapitalismus, die exzellente Facharbeit ohne Streiks. Hier war und ist in einer zwar kurzen, weil auf Dauer nicht haltbaren, aber für einige Jahre doch sehr profitablen Situation das zu haben, was es in keinem anderen Land im Doppelpack gibt: unternehmerische Willkür und Loyalität der Lohnabhängigen. Das wissen nicht nur die Amerikaner auf Münteferings schwarzer Liste, sondern auch manche deutsche Konzernchefs, die er nicht zu nennen wagt.
Selbstverständlich wäre es übertrieben, die politische Verantwortung für unternehmerische Exzesse beim Heuschrecken-Kläger und seinen Regierungsgenossen allein zu suchen. Zu nennen sind auch all die Propagandisten aus Opposition, Wissenschaft und Medien, die mit ihrer Fixierung auf Unternehmenslasten und Arbeitskosten zu einer Analyse neigen, die von ausländischen Volkswirten mittlerweile als typisch deutsche Irrationalität wahrgenommen wird. Aber selbst wenn man dieses Klima der Hysterie berücksichtigt und, in aller Fairness, die Zwänge des Weltmarktes, die Vorgaben der EU und die internationalen Kapitalströme würdigt, bei der Fahrt in die Sackgasse, in der das Land wirtschafts- und sozialpolitisch steckt, saßen Sozialdemokraten am Steuer. Hätten sie das intellektuelle Format und den Mut, das Hofieren von Konzernen, das sie selbst jahrelang praktiziert haben, als untauglichen Politikersatz zu erkennen, könnte die Müntefering-Debatte vielleicht ein Auftakt sein, um jenseits beklagenswerter Symptome die groteske Einseitigkeit der deutschen Reformdiskussion zu relativieren. Dann allerdings wäre nicht nur über Entsendegesetze und Managergehälter zu reden, sondern über gerechte, von ausnahmslos allen Erwerbstätigen finanzierte Sozialsysteme, über steigende statt sinkende Körperschaftsteuern und die Verteilung von Einkommen und Vermögen. Wer es nicht wagt, diese heiligen Kühe in die Debatte zu scheuchen, sollte über Heuschrecken schweigen.