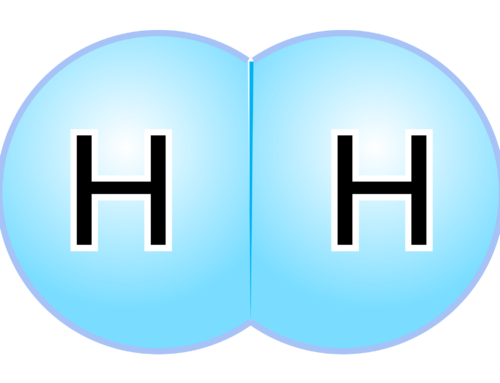Blick zurück und nach vorn: Grundeinkommen für alle, 25-Stunden-Woche und ökologische Vernunft wären, wenn ein Ruck durch die Gesellschaft ginge, nicht Utopie, sondern Tagesprogramm
Ketzer haben schon geäußert, dass es nun gut sei mit dem Sandkastenspiel. Schluss mit den Märchen und bitte jetzt wieder den herrschenden Gestalten den Marsch blasen. Wenn der Fluss der Visionen stockt, sollte man wohl tatsächlich einen vorläufigen Schlusspunkt setzen. Aber die Aufforderung, Gegenwelten zu erfinden, wird nicht storniert. Sie werden auch künftig im Freitag ihren Platz haben. Denn die hartgesottenen Pragmatiker übersehen, dass nicht nur das Heranwachsen der Kinder, sondern auch der gesellschaftliche Gärungsprozess von phantasievollen Erzählungen lebt. Auf unserer Internetseite www.freitag.de wird die Debatte, ergänzt durch bisher nicht gedruckte Texte, ihren Platz behalten.
Vor fast 500 Jahren beschrieb Thomas Morus, der spätere Lordkanzler unter König Heinrich VIII. und schließlich dessen Opfer auf dem Schafott, eine ferne Insel. „Die Kinder gehorchen dem Weibe, das Weib dem Manne“ – von moderner Pädagogik und Gender Mainstreaming haben ihre Bewohner noch nichts gehört. Aber jenseits dieser Schranke herrscht Freiheit, die sich auf Gleichheit gründet. Der Sechs-Stunden-Arbeitstag soll gelten, für alle, ohne Ansehen der Person. Im Reich der Vernunft, dem Thomas Morus mit seinem „Utopia“ Gestalt geben will, haben Privilegien keinen Platz, weder die feudalen der Geburt noch – Morus war der erste, der es ausspricht – die bürgerlichen des Privateigentums.
Mit „Utopia“ beginnt die lange Reihe der Gegenwelten, die immer wieder beides waren: Spiegel der heraufziehenden bürgerlichen Epoche und Entwurf der menschlichen Möglichkeiten über den gegebenen Zustand hinaus. Von den großen Debatten der französischen und amerikanischen Gründungsväter, über die utopischen und die wissenschaftlichen Sozialisten bis hin zu den feministischen und ökologischen Gesellschaftsentwürfen – zu jeder Zeit gab es, ob in kleinen Zirkeln oder großen Bewegungen, die Vorstellung, dass der jeweilige Status quo nicht das letzte Wort der Geschichte sein könne. Stets war er da, der gedankliche Überschuss, der sich nicht nur als Folie der Kritik, sondern auch als Vorwegnahme einer besseren Gesellschaft anbot.
Seit der großen Zeitenwende von 1989-91 scheint der Vorrat aufgebracht. Das sei auch gut so, behaupten manche, denn im Namen der Gegenwelten sei zu viel Unrecht geschehen, und andererseits, so der Japano-Amerikaner Francis Fukuyama, habe die menschliche Geschichte mit der Kombination von liberaler Demokratie und Kapitalismus ihre endgültige Form gefunden. Tatsächlich gibt es heute mehr gewählte Regierungen als jemals zuvor, und auf dem Globus herrscht nahezu lückenlos das ökonomische System von Lohn, Preis und Profit. In den einzelnen Ländern, so die Schlussfolgerung aus diesem doppelten Trend, könne es nur noch darum gehen, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, die entstehenden Sachzwänge technokratisch zu exekutieren. Und wo es klemmt beim großen Modernisierungsschub, helfen die großen Spieler mit Dollars und ferngesteuerten Bomben.
Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass die Ergebnisse dieser kühlen Rationalität merkwürdig einseitig sind. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich werden größer, national wie global. Löhne stagnieren, Kapitaleinkommen explodieren. Soziale Standards werden gelockert, Kulturprojekte gestrichen. Was sich nicht unmittelbar rechnet, gerät unter Rechtfertigungszwang. Einige Regionen profitieren vom „race to the bottom“, andere versinken in Chaos und Anarchie, und in Nordamerika, Westeuropa und Japan, also dort, wo die geistigen Ressourcen vorhanden wären, um über einen Ausgang aus dem selbstverschuldeten Irrsinn nachzudenken, paart sich die Vielfalt technologischen Fortschritts mit ökonomischem Einheitsdenken und – darf man es aussprechen? – mit kulturellem Verfall.
Hinzu kommt ein historisch beispielloses Mega-Event, dessen Vorboten selbst vom Pentagon nicht mehr geleugnet werden: die drohende Klimakatastrophe, die uns allen die ökologische Rechnung einer nicht mehr tragfähigen Produktionsweise präsentiert. Die Weltgesellschaft, so wie sie gegenwärtig verfasst ist, läuft auf einen Abgrund zu, aber als Empfehlung hören wir nur: Bitte lauft doch noch etwas schneller.
Die Menschheit stellt sich nur Aufgaben, die sie auch lösen kann, hat Karl Marx einmal behauptet. Wenn wir für einen Augenblick von der herrschenden Idiotie abstrahieren, die ausgerechnet heute, im Angesicht wechselseitiger Abhängigkeit und Verletzlichkeit, den selbstsüchtigen Nutzenmaximierer zum Helden erklärt, werden die Chancen durchaus sichtbar, die unter der Oberfläche schlummern. Technisch ist die vollständige Ablösung fossiler und atomarer Energie möglich. Auf einer neuen Ressourcenbasis könnten Wirtschaftskreisläufe entstehen, die regionale Souveränität begründen. In den verarmten Problemzonen würden sich Bauern in Energiewirte verwandeln. Die Sonne wäre für die Länder des Südens nicht länger ein Fluch, sondern ein Standortvorteil. Im Austausch mit dem Norden könnten sie einen Pfad beschreiten, der sich von vornherein auf die heute schon vorhandenen Technologien dezentraler Produktion und Kommunikation stützt.
Gäbe es global eine Verständigung über solche sozialen und ökologischen Entwicklungsziele, müssten auch die Industrieländer für sich selbst eine neue Agenda formulieren. Statt den Druck im Kessel und das Tempo des Hamsterrrades immer weiter zu steigern, wäre das Gegenteil geboten. Nicht weniger, sondern mehr soziale Sicherheit, nicht längere, sondern kürzere Arbeitszeiten sind nötig, um Engagement und Kreativität freizusetzen, um die Produktivkräfte dem ökologischen Imperativ anzupassen. Grundeinkommen für alle, 25-Stunden-Woche und stetig sinkender Ressourcenverbrauch wären, wenn ein zeitgemäßer Ruck durch die Gesellschaft ginge, nicht Utopie, sondern Tagesprogramm.
Der schreiende Widerspruch zwischen dem, was technisch und wissenschaftlich schon möglich ist oder zumindest denkbar wäre, wenn man den menschlichen Genius in andere Bahnen lenken würde, und dem Katastrophenkurs der herrschenden Eliten war der Ausgangspunkt der Freitag-Debatte über konkrete Utopien. Nicht Märchen waren erwünscht, sondern realistische Leitbilder. Im Unterschied zu den aktuellen Reformdebatten, die soziale Besitzstände, aber niemals das bürgerliche Eigentumsprivileg antasten, sollte das Kapital als Variable mitgedacht werden. Hat die Privatwirtschaft bisheriger Art ihren Zenit längst überschritten oder kann sie noch wertvolle Dienste leisten, wenn sie sich veränderten Prioritäten beugt? Ist nichts anderes vorstellbar als Fukuyamas Doppelpack oder gedeihen vielleicht doch irgendwo Keimformen anderen Arbeitens und Lebens, die zu verallgemeinern wären? Wie kann man die ungeheuren Produktivitätsfortschritte so nutzen, dass sie nicht zur Bedrohung werden, sondern zu Freiheitsgewinnen führen? Oder mit Friedrich Schiller: Wie kann man das Rad in seinem Umschwung wechseln?
Solche grundsätzlichen Fragen werden naturgemäß sehr unterschiedlich beantwortet. Niels Boeing begann mit einem Streifzug durch den Großstadtdschungel und entdeckte den Typus des modernen Behème, der sich mitten im hektischen Getriebe eine eigene Welt baut. Für ihn sind die Netzwerke der Einzelunternehmer, Scheinselbstständigen und Freiberufler, die ihren Konsum begrenzen und ein wechselseitiges Geben und Nehmen inszenieren, nicht eine Notlösung, sondern ein Zukunftsmodell. Anschließend empfahl Michael Jäger, Marktwahlen abzuhalten, damit die Richtung des technischen Fortschritts einem demokratischen Votum zugänglich wird und nicht mehr dem Diktat der Konzerne unterliegt.
Nach diesen beiden Entrées, die eher zu verhaltenen Reaktion führten, folgte mit den Beiträgen von Franz Schandl, Stefan Meretz, Hermann Scheer, Ulrich Weiß, Rainer Fischbach, Ulrich Busch, Robert Kurz, Christoph Spehr und Annette Schlemm die zentrale Kontroverse, die sich um die Fragen rankt: Ist mit dem institutionellen Erbe der bürgerlichen Epoche – also mit Kapital, Markt, Geld und parlamentarischer Demokratie – eine lebenswerte Zukunft möglich oder müssen sie, weil sie immer wieder Katastrophen reproduzieren, völlig neuen gesellschaftlichen Arrangements weichen? Bleibt angesichts der bevorstehenden dramatischen Klimaveränderung und der zu erwartenden Kämpfe um Ressourcen, die ja, siehe Irak, schon begonnen haben, überhaupt noch Zeit für die geistige und praktische Arbeit an anderen Gesellschaftsentwürfen?
Nein, diese Zeit bleibt nicht, behauptete Hermann Scheer. Innerhalb des vorhandenen Wirtschaftssystems herkömmliche Energien durch solare zu ersetzen, sei die einzige realistische Option. Es gibt nur eine solare Ökonomie oder gar keine – so lautet seine These. Und, so Scheer, die Veränderung der Ressourcenbasis ist selbst schon die entscheidende gesellschaftliche Transformation. Das Gegenargument lautet: Gerade weil die Zeit drängt, können wir uns das Drehen an dieser oder jener technologischen Schraube nicht mehr leisten. Wir brauchen einen Systembruch. Ein Reformismus à la Scheer bleibt hinter der Dramatik der Probleme zurück.
Nur wie könnte sie aussehen, die Alternative zum heiß gelaufenen kapitalistischen Rad? Das Modell Linux, die Idee, in freier und unentgeltlicher Kooperation künftig vielleicht nur Softwareprogramme, sondern auch Musik, wissenschaftliche Erkenntnisse und Kultur im weitesten Sinne hervorzubringen, ist ein Hoffnungsträger – und bleibt letztlich doch, warnt Rainer Fischbach, ein Nischenphänomen. Christoph Spehr dagegen bezieht sich ausdrücklich auf den Linux-Ansatz, stellt den Sinn geistigen Eigentums in Frage und entwirft einen offenen Sozialismus, in dem das gesamte Kapital nach dem Prinzip „One man – one vote“ zu gleichen Teilen auf alle übertragen und in Kooperativen organisiert ist.
Für manchen war das zuviel der Utopie. Nicht überraschend meldeten sich schließlich die radikalen Realisten zu Wort. Fritz Reheis fragte nach dem gemeinsamen Nenner verschiedenster Forderungen und formulierte Entschleunigung als bündnisfähiges Ziel. Mit Michael Opielka und Gisela Uhlenhut schloss sich der Kreis: Mit zwei Varianten eines Grundeinkommens, jeweils gedacht als Alternative zu Hartz IV, war die Debatte wieder auf dem Boden der real existierenden Bundesrepublik angekommen.
Obwohl nun ein vorläufiger Schlussstrich gezogen wird, bleiben die Thesen, die Anregungen und die aufgeworfenen Fragen hoffentlich eine permanente Aufforderung. Denn die Menschheit steht vor der Aufgabe, sich selbst neu zu setzen, neu zu erfinden als eine zu radikaler Selbstreflexion fähige Spezies. Diese Ungeheuerlichkeit, diese gewaltige Last, wird nur dann zu bewältigen sein, wenn sich die Abwehr von Gefahren mit Visionen verbündet, die begeistern können. Stellen wir uns vor, die Welt, so wie sie ist, hätte sich blamiert und eine kritische Masse von Erdenbürgern würde sich fragen: Was machen wir denn nun? Es wäre peinlich, wenn wir bis dahin den Faden von Thomas Morus nicht aufgenommen hätten und Francis Fukuyama gesenkten Hauptes bestätigen müssten.