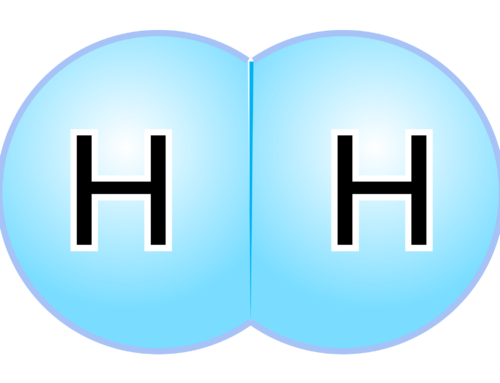Schluss mit dem Angleichungsgerede: Horst Köhler kündigt den Gründungsmythos von 1990
Nach einem Terroranschlag darauf hinzuweisen, dass es schon immer Terror gegeben habe, ist eine historisch begründete und dennoch, für jeden erkennbar, eine zynische Haltung. Wer würde die Hinterbliebenen eines Mordopfers mit dem Hinweis zu trösten versuchen, dass Mord nun mal zur menschlichen Geschichte gehöre? Ein Barbar, der solches sagt, ist Horst Köhler natürlich nicht, jedenfalls nicht in den elementaren Angelegenheiten des Todes und der Tröstung.
Gegen den Terror fordert er den starken Staat. Auch die friedensstiftende Kraft des Symbolischen ist unserem Bundespräsidenten bewusst. Wenn er im Berliner Abgeordnetenhaus an einem großen Gemälde über den Fall der Berliner Mauer vorbeigeht, vermisst er ein „bekanntes ostdeutsches Gesicht“. Damit will er den Menschen in den neuen Ländern sagen, „dass sie mit der friedlichen Revolution etwas ganz Großes für Deutschland geleistet haben, wofür wir alle dankbar sind“. Ins Gruppenbild mit Kohl, Genscher und Brandt gehört der Quoten-Ossi – so viel Anstand muss sein. In den entscheidenden Fragen hat Köhler ein weiches Herz. Aber in seinem eigenen Fach, in seiner Lieblingsrolle als ökonomischer Aufklärer, verliert er immer wieder die Contenance. Schluss mit dem Angleichungsgerede – das war zu früh und zu forsch. So freimütig redet man nicht, wenn die Meinungsbildung im Establishment noch nicht abgeschlossen ist.
Soll man ihm für die Offenheit danken oder seinen Zynismus verurteilen? Den Gründungsmythos der neuen deutschen Republik ad acta zu legen, wäre zweifellos ein großer Fortschritt, wenn Köhler den Blick auf den erbärmlichen Zustand der inneren Einheit hätte lenken wollen. Seit acht Jahren findet Angleichung nicht mehr statt und künftig werden – mit Abwanderung und Kaufkraftschwund – weite Teile des Ostens noch weiter hinter den Westen zurückfallen. „Wir dürfen diesen Niedergang nicht hinnehmen und brauchen einen neuen Ansatz für den Aufbau Ost“ – für einen verfassungstreuen Präsidenten wäre diese Schlussfolgerung zwingend gewesen, aber nicht für Horst Köhler. Für den ehemaligen Direktor des Internationalen Währungsfonds gehört die Verschrottung ganzer Regionen offenbar zum normalen Geschäft. Bedauerlich, aber nicht zu ändern.
Köhlers Äußerung ist der vorläufige Höhepunkt in einer langen Reihe ähnlicher Stellungnahmen. Nachdem der Spiegel im Frühjahr von 1.250 verschwendeten Milliarden gesprochen hatte, wurde die Parole „Vergesst den Osten“ gesellschaftsfähig. „Wie können wir Deutschlands Osten auf die Beine helfen?“ fragte im August Karl Schweinsberg, der Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Impulse. „Die Antwort ist so einfach wie grausam: überhaupt nicht. Jeder Euro, der an Hilfe in den Osten fließt, ist ein Euro zu viel.“ Anfang September veröffentlichte der stern eine bemerkenswerte Umfrage: zwölf Prozent der Ostdeutschen und 24 Prozent der Westdeutschen wollen die Mauer zurück. Und in der Zeit fleht Helmut Schmidt ebenso leidenschaftlich wie hilflos, dass die Ostdeutschen ihre Forderungen mäßigen müssten, damit die Westdeutschen bei der Stange bleiben. Mit radikaler Entbürokratisierung und Steuervorteilen für ostdeutsche Betriebe sei ein Neuanfang möglich, meint der Weltökonom.
Er irrt. Technokratisch an dieser oder jener Schraube zu drehen, reicht nicht mehr. Fällig ist zunächst die Einsicht: Die deutsche Einheit ist ein gescheitertes Projekt – mental, politisch, ökonomisch. Und in dieser Reihenfolge – mental, politisch, ökonomisch – müsste das Scheitern der vergangenen 15 Jahre aufgearbeitet werden, wenn es eine neue Chance geben soll.
Bislang hat die Mehrheit der Westdeutschen keinerlei Bewusstsein über den feudalen Status, den sie – im Verhältnis zu den Ostdeutschen – permanent für sich reklamiert. Das überlegene Lächeln, das herablassende Mitgefühl, der zynische Schlenker als Treibsatz für den selbstverliebten Dreifachsalto um das eigene Ego – für die Mehrheit der Ostdeutschen ist all das nur noch grotesk und lächerlich. Doch der geistige Kolonialismus der sogenannten Eliten gibt dem westdeutschen Hasen immer wieder Pfeffer: „Die Menschen in den jungen Bundesländern müssen begreifen…“ Die Ostdeutschen ihrerseits fügen sich immer noch allzu oft in die vorgesehene Rolle statt frech, mit Witz und Selbstbewusstsein, der ständigen Verhöhnung entgegen zu treten.
Wäre die geistige Lage der Nation weniger von dieser Herr-Knecht-Dialektik beseelt, könnte vielleicht auch die Aufarbeitung politischer Fehler beginnen. Die Liste ist lang: In Gestalt der Währungsunion eine ökonomische Massenvernichtungswaffe gezündet, die verbliebenen Reste, die sich als robust erwiesen, an westdeutsche Jäger und Sammler verkauft und drittklassige Westbürokraten als Verwalter berufen – dass ein solcher „Aufbau“ nur auf Zerstörung hinauslaufen kann, sollte in einem rationalen Diskurs eine Selbstverständlichkeit sein. Und wer nicht den Mut hat, die Vermögenden in Westdeutschland, die mit Rückübertragungen und Sonderabschreibungen bereits verwöhnt wurden, an den Lasten zu beteiligen, wer nahezu ausschließlich die Lohnabhängigen zur Kasse bittet, setzt einen Spaltpilz, der irgendwann das Klima vergiftet. Auch diese Einsicht gehört in die deutsch-deutsche Debatte. Denn in diesem Irgendwann leben wir heute.
Gibt es noch eine Chance? Wer unbedarft durch die ostdeutsche Landschaft fährt, wird mit der Gegenfrage antworten: Warum denn nicht? Die Infrastruktur ist intakt, für alles Wesentliche ist gesorgt. Aber wer sehen kann, der könnte auch genauer hinsehen. Hinter den bunten Kaufhausfassaden türmen sich Warenberge, die – wie in kaum einem anderen Teil Europas – überwiegend nicht aus eigener Produktion stammen. Die Produktionsstätten liegen im Westen, und die Menschen ziehen hinterher. Das muss auch so sein, hat nun der Bundespräsident erklärt und damit das Projekt Deutsche Einheit zu Grabe getragen. Die Hinterbliebenen können sich mit dem netten Hinweis trösten, dass der Tod von Regionen nun mal zur menschlichen Geschichte gehört. Mit Zynismus hat das nichts zu tun.