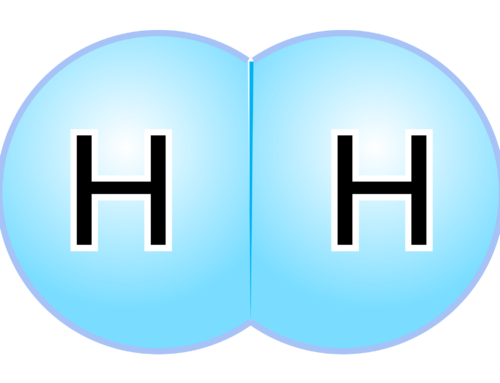Mit Karl Marx auf Ochsentour: Der ungewöhnliche Weg des Unternehmers Siegfried Hanke, der auf den Faktor Arbeit setzt und allen misstraut, die nur ans Geld denken
Ein Schmelztiegel mit 750 Grad heißem Aluminium dreht sich allmählich in die Horizontale. Silbrige, rotglühende Lava fließt in den Einfülltrichter eines tonnenschweren Dosierofens. Das Kunststück vollbringt Wolfgang, der Schmelzer, mit einem speziell dafür hergestellten Gabelstapler. Er hat bereits seit vier Uhr in elektrisch beheizten Öfen das Metall vorbereitet und versorgt nun fünf Kollegen mit dem Rohstoff, den sie an diesem Tag mit ihren vollautomatischen Druckgießanlagen und ihren Robotern in mehrere tausend Autoteile verwandeln werden.
Als erster ist Kay dran, 21-jähriger Azubi im zweiten Lehrjahr. Seine Anlage ist die einzige ohne Roboter. Mit einer Zange greift er in die Maschine, die nach jedem „Schuss“ eine Schließkraft von 350 Tonnen freigibt und sich in der Mitte öffnet. Eine Hochdruckpistole in seiner linken Hand säubert, kühlt und fettet die beiden Hälfen der Druckgießform aus hochlegiertem Stahl, die in der Maschine verankert ist. Er nimmt das Werkstück heraus, das einem zweiarmigen Kerzenständer gleicht. Kurzer Blick auf das Materialgefüge, die Oberfläche und die neuralgischen Punkte. Für gut befunden, wandert der Schuss in eine Gitterboxpalette, die nach drei Stunden mit 500 Gehäusen für Gasregelgeräte gefüllt sein wird, gegossen in Eberswalde bei Berlin im Auftrag eines amerikanischen Konzerns.
Vertrauen in die junge Garde
Kann man einem Azubi soviel Vertrauen schenken? Man kann, man kann ihn sogar nach abgeschlossener Lehre mit finanzieller Unterstützung der Firma zum Studium „delegieren“. Kay soll, so ist es per Handschlag vereinbart, als Ingenieur in den Betrieb zurückkehren, Produktionsleiter werden, Verantwortung übernehmen. So wie Stefanie, die – mit 23 eine der Jüngsten im Betrieb – für die Programmierung sämtlicher Roboter zuständig ist. Der Mann, der konsequent auf seine junge Garde setzt, heißt Siegfried Hanke. Fünf-Tage-Bart, kariertes Jackett und graues Polohemd, mit kindlich leuchtenden Augen erklärt er mir vor Produktionsbeginn die Geheimnisse seines Betriebs. Typ Wissenschaftler, denke ich zunächst, wären da nicht die knappen, präzisen Sätze und der immerzu wippende, kerzengerade Körper, der Autorität ausstrahlt, vor allem aber Haltung. Persönliche Haltung – das zeigt sich schon bald – ist das Thema dieses 52-jährigen Unternehmensgründers, der aus dem Nichts einen kleinen „Global Player“ geschaffen hat, der Toyota, DaimlerChrysler, Ford, Jaguar und die Adam Opel AG mit hochwertigen Druckgussprodukten versorgt.
Haltung zum eigenen Leben, zur Arbeit, zu den Mitarbeitern, den industriellen Partnern und zur Gesellschaft – was ist das? „Am liebsten arbeite ich mit Leuten zusammen, die selbstständig entscheiden, bereit sind, für ihr Tun Verantwortung zu übernehmen und von einem unbedingten Leistungswillen beseelt sind.“ Geht es nicht auch um Macht, Erfolg und Geld? „Das sind Trophäen, die man vorzeigen kann, die mich aber letztlich nicht motivieren“, behauptet Hanke. Mancher westdeutsche Vertragspartner habe ihn schon für verrückt erklärt, weil er so zweideutig über Geld rede. „Die haben eben ihren Karl Marx nicht gelesen, denken nur in Geldkategorien und haben das alte Prinzip des Gebrauchswerts schon fast vergessen. Das, was ich will, was ich mir strategisch vorgenommen habe, kann ich aber nicht primär mit Geld regeln. Ich will eine Kooperation mit mittelständischen Firmen, die in erster Linie an ihrer Leistung interessiert sind und die sich gegenseitig vertrauen. Ich will ein langfristig funktionierendes Kooperationsnetz. Wer nur auf seinen Vorteil für den Moment achtet, hat darin keinen Platz. Von Partnern, die sich nur über Geld definieren, trennen wir uns.“
Kann jemand, der so denkt, überhaupt einen Betrieb führen? Muss er nicht seine Mitarbeiter, die schließlich keine geborenen Unternehmer sind, permanent überfordern? „Ich setze harte Anforderungen, wähle mein Personal sehr sorgfältig aus, aber ich weiß natürlich auch, dass das Team, das ich brauche, nur ganz allmählich entstehen kann. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Erziehungsprozess, mit dem Ziel, dass sich jeder mit seinen spezifischen Möglichkeiten in ein souveränes Subjekt verwandelt.“
Und so steht er nun – es ist sieben Uhr 30 und Kay hat schon einige Dutzend Schuss hinter sich – vor neun Männern und acht Frauen, alle in olivgrünen Overalls mit dem Schriftzug „Hanke“ auf der Brust. Der Chef überreicht die „Lohnscheine“, auf denen alles steht, was sie im Verlauf des Tages bringen sollen. Ganz unten rechts auf dem mehrfarbigen DIN-A4-Blatt steht unübersehbar eine Null. Kein Ausschuss soll das bedeuten, und wenn doch etwas schief geht, wird nachgearbeitet, bis die Null steht. In knappen Worten werden Stückzahlen und technische Details erläutert. Mit Witz und Charme – Typ Brigadier, könnte man jetzt denken – eröffnet Hanke den Tag.
Ein paar Semester Musik
Später – an den Maschinen wird schon gegossen – frage ich ihn: „Arbeiter im Einheitslook, Lohnscheine mit genauen Vorschriften und Sie sind, bei aller Konzilianz im Ton, doch eindeutig der Kommandant – ist es nicht zynisch, wenn Sie da von souveränen Subjekten sprechen?“ Hanke lacht, er hat den Einwand schon häufig gehört. „Sie machen den gleichen Fehler wie meine Unternehmerfreunde. So wie die nur aufs Geld achten, so schauen auch Sie nur auf Äußerlichkeiten. Natürlich bin ich hier der Boss, auch ganz formell, weil mir der Laden gehört. Vor allem aber definiere ich mich über meine Kompetenz. Ich kann jede Anlage selbst bedienen und zögere nicht, das auch zu tun, wenn es eng wird. Wenn ich nur oben in meinem Büro sitzen würde, kämen mir viele Ideen gar nicht erst in den Kopf. Zwischen mir und meinen Leuten entwickelt sich allmählich ein wechselseitiger Lernprozess. Wenn ich dabei vom unbestrittenen Chef zum primus inter pares werde, dann ist das genau das, was ich will. Selbstverständlich kann ich nicht allein auf Vertrauen setzen, sondern muss auch Kontrolle ausüben. Nur darf man nicht vergessen, ich habe ja gewissermaßen auch meinen Lohnschein. Ich muss die Aufträge reinholen. Für die Kompetenz gegenüber dem Kunden müssen wir letztlich alle gemeinsam sorgen. Das kommt langsam in die Köpfe und wird auch mit den entsprechenden Prämien honoriert.“
Wie kam Siegfried Hanke – doppelt diplomiert in Maschinenbau und Betriebswirtschaft, dazu noch ein paar Semester Musik – zu seinem merkwürdigen Geschäftsmodell, zu seiner Philosophie, die den Faktor Arbeit lobt und dem Primat der Kapitalverwertung misstraut? Hanke erinnert sich ans Frühjahr 1990. Er ist gerade Betriebsleiter des VEB Druckguss Weißensee geworden, nicht ernannt, auch nicht gewählt, sondern irgendwie von den Kollegen „ausgeguckt“. „Wenn einer es schafft, uns in die Markwirtschaft zu führen, dann am ehesten der Hanke.“ Ihm aber ist schon vor der Währungsunion klar, dass sein Betrieb kaum eine Chance haben würde, gegen westdeutsche und weltweite Konkurrenten zu bestehen. Und so kam es dann auch. Nach dem 1. Juli 1990 hat der volkseigene Betrieb, zwischenzeitlich zur GmbH geworden, vier Wochen lang keinerlei Umsatz, weil die alten sozialistischen Kunden verschwunden und die neuen kapitalistischen Auftraggeber noch nicht da sind.
„In der Not haben wir unser Inventar durchforstet. Wir hatten Stahl- und Aluminiumbestände. Die haben wir dann in Hanau versteigert und aus dem Erlös erstmals die Löhne in D-Mark ausgezahlt. Erst Ende August begann wieder die eigentliche Produktion. Mein Ziel zu dem Zeitpunkt war, ganz schnell zu privatisieren, damit wieder Ruhe reinkommt und ein Rest von Arbeitsplätzen noch gesichert werden kann. Wir waren dann auch eine der ersten ostdeutschen Firmen, die vollständig privatisiert wurde.“
Das Geheimnis des Flunders
Unter dem neuen Eigentümer, einer westdeutschen Industrie-Holding, sieht Hanke für sich keine erstrebenswerte Perspektive. Alles wegzurationalisieren, was nicht unmittelbar betriebsnotwendig ist, ist für ihn noch längst kein Konzept. Er beobachtet die internationale Szene. Schon damals ist „Lean Production“ modern, schlanke Produktion mit flachen Hierarchien. Hanke stellt sich die Frage: Was wird passieren, wenn wir alle Flundern sind? Wenn die Hierarchien zu einer einzigen Linie schrumpfen, was ist dann der nächste Schritt? Glatter als glatt geht ja nicht. Seine Konsequenz: Auch „Lean Production“ wird in absehbarer Zeit ein Auslaufmodell sein. Kooperation statt Hierarchien, ein Netzwerk von Selbstständigen muss das traditionelle Gefüge von Chefs und Untergebenen ablösen, denkt Hanke und ist damit jener Zeit weit voraus, die sich später „New Economy“ nennen wird.
Nur wie soll er seine Ideen umsetzen? Er hat kein Kapital und von den Banken bekommt er keins. Der Zufall hilft. Am Telefon meldet sich der Sprecher einer Firmengruppe aus Frankfurt/Main, die einen Gussbetrieb im thüringischen Sömmerda übernehmen will. Hanke hat gerade Urlaub, man trifft sich in Berlin. Zwei Wochen später unterschreibt er seinen Geschäftsführervertrag, bleibt aber skeptisch. Haben die Herren aus dem Westen seine Ideen verstanden? Nehmen sie ihn überhaupt ernst? Wenn es nicht klappt, beruhigt er sich, bleibt vom hohen Gehalt zumindest ein gutes Stück Startkapital für neue Perspektiven übrig.
Tatsächlich scheitert er dann auch sehr schnell mit seinem Versuch, die traditionelle, wenig spezialisierte Massenfertigung zu überwinden. „Meine neuen Chefs“, resümiert Hanke, „wollten einfach nicht einsehen, dass man in einem Hochlohnland Intelligenz in die Produkte hineinbringen und den Produzenten Verantwortung übertragen muss, damit alle vermeidbaren Arbeitsschritte tatsächlich eingespart werden.“ Nachdem er hautnah miterlebt hat, wie auch ein westlicher Betrieb in Traditionen erstarrt sein kann, will er nur noch raus. Das allerdings geht nicht so schnell. Er hat einen gültigen Vertrag. Bei einer ordentlichen Kündigung müsste er noch ein Jahr weiterarbeiten und danach, so sieht es die vereinbarte „Konkurrenzsperre“ vor, drei weitere Jahre auf jedes Engagement in der Branche verzichten. „Ich habe denen dann gesagt, dass ich auf alle finanziellen Ansprüche aus dem Vertrag verzichte, wenn sie mich nur gehen lassen. Das taten sie dann auch, und so wurde ich ein freier Mann.“
Mitte 1993 beginnt Hanke mit einem angestellten Ingenieur und seiner Frau als Prokuristin ein neues Leben, das er programmatisch „HANKE Gesellschaft für Gießerei-Kooperation“ nennt. Ein kleines Guthaben auf dem Konto, verschiedene Kontakte zu Automobilfirmen und vor allem das Selbstbewusstsein, das Gussgeschäft besser machen zu können als andere – mit diesem Kapital beginnt Hanke in einem kleinen Büro in Berlin-Weißensee. Er will ein Partnergeflecht schmieden und sich selbst ganz auf die Entwicklung neuer Formen konzentrieren, mit denen komplizierte Werkstücke effizienter gegossen werden können. An eine eigene Fertigung mit eigenen Maschinen denkt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Die Ochsentour der Partner- und Kundensuche beginnt. „Wir haben damals im Monat bis zu 70 Angebote geschrieben und im Jahr mehr als 1.000 Anfragen abgewickelt.“ Einer der ersten Kunden kommt aus Eisenach, Zulieferer für Opel. „Dem haben wir nachgewiesen, dass wir die Gussteile, die er benötigt, mit unseren Methoden 30 Prozent billiger herstellen können als die Konkurrenz.“
Dem erfolgreichen Einstieg folgt aber schon bald die Ernüchterung. Die vereinbarten Stückzahlen müssen auch verlässlich geliefert werden, von den Gießereibetrieben, die Hanke vertraglich gebunden hat. Nach einigen Fehlschlägen sieht er ein, dass sein Kooperationsmodell zwar mit flexiblen Technologiepartnern, aber kaum mit traditionellen Produktionsfirmen funktioniert. Er muss also das tun, was er eigentlich gar nicht will: eine eigene Gießerei aufbauen. Der selbstständige Ingenieur muss, wenn er seiner Idee treu bleiben will, Industrieller werden.
Wenn Platzeck kommt
Beim weiteren Rundgang durch sein Reich werden die vergangenen sechs, sieben Jahre räumlich sichtbar. Hallenmodule, nach Bedarf gebaut, reihen sich aneinander. Ganz zum Schluss ein 300 Quadratmeter großes Zentrum für die Endbearbeitung, das nach frisch verlegtem Linoleum riecht. Verloren in der Ecke eine computergesteuerte, teure Maschine, die – mit 20 Werkzeugen bestückt – im Takt von Sekunden bohrt und fräst. „Auch das, was Sie hier sehen, ist ein Ergebnis besonderer Kooperationsbeziehungen. Einen Großauftrag konnten wir nur mit dieser zusätzlichen Maschine und einer entsprechenden räumlichen Erweiterung durchführen. Um aber beides finanzieren zu können, brauchten wir wiederum den Auftrag. Die Katze biss sich also in den Schwanz. Also sind wir zur Stadtverwaltung und zur Bank marschiert und haben denen vorab unser Dilemma, aber auch unsere Planung auf den Tisch gelegt. Und so klappte das dann: Wir haben den Auftrag mit engen Lieferfristen angenommen, innerhalb von Tagen kamen sowohl die Bankfinanzierung als auch die Baugenehmigung und sechs Wochen später stand die Halle.“
Auf solche Wunder ist Hanke stolz, trotzdem beunruhigen sie ihn. Wenn seine Firma weiter expandiert, wird er irgendwann nicht mehr 40, sondern 80 oder 120 Mitarbeiter haben. Wird dann seine Vision einer von Teamgeist und individueller Kompetenz getragenen Belegschaft den Gesetzen der Akkumulation zum Opfer fallen? Wird er dann zum ganz normalen Vorstandschef eines hierarchisch gegliederten Unternehmens? In diesem Augenblick, in dieser einsamen Halle, verlassen wir den engen Horizont unseres bisherigen Gesprächs. „Was wäre,“ frage ich ihn, „wenn Sie sich irgendwann bewusst werden, dass Ihre ganze Leidenschaft einem fragwürdigen Ziel dient? Schließlich sind Sie Zulieferer der Automobilindustrie, die sich anschickt, unseren Planeten zu zerstören.“ Hanke ist ehrlich genug, um sofort zuzugeben, dass die Zunahme motorisierter Mobilität ein Wahnsinn ist. „Aber wenn es um Fragen des Systems geht, bin ich bestenfalls Reformer. Ich kann nur dazu beitragen, dass in der langen Produktionskette der Automobilindustrie unsinnige Transportwege durch intelligente Abläufe vermieden werden. Auf die Verwendung des Endprodukts habe ich keinen Einfluss.“
Ist das nicht zu bescheiden? Könnte Hanke, der gestandene Unternehmer, nicht doch viel mehr, als er sich zugesteht, Einfluss nehmen? „Wissen Sie, vor drei Wochen war Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck hier. Die rufen dann vorher an und möchten wissen, welche Probleme es gibt. Ich habe denen klipp und klar gesagt, dass es keine Probleme gibt, die sie lösen könnten. Wenn sie mir überhaupt etwas anbieten können, dann sind das mittelfristige Strategien. Aber so etwas haben die ja nicht.“
Mittelfristige Strategien – das wäre in der Tat ein passendes Stichwort. Wenn es so etwas gäbe, dann würde vielleicht auch Siegfried Hanke seine Energien neu ausrichten. Morgens um fünf steht er auf, um das Ergebnis seiner Träume sofort in den Computer zu tippen. Was wäre, wenn diese Besessenheit nicht nur neue Druckgussformen und Automobilteile, sondern auch ökologisch sinnvolle Gebrauchswerte hervorbringen würde? Vielleicht ist dieser Hanke, der auf die Menschen setzt und die Grenzen des Geldes kennt, eine Antwort auf die uralte Frage, wer denn in einer anderen Welt die Unternehmerfunktion wahrnimmt. Ohne solche Typen wird es nicht gehen.