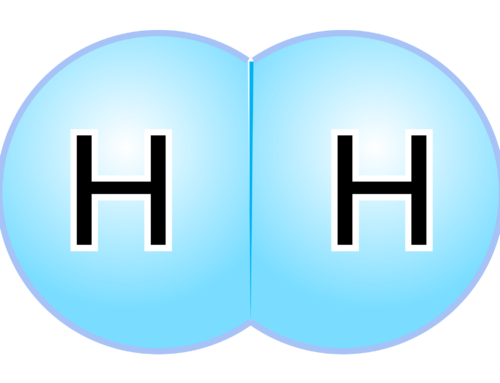Wo bleibt der Öko-Marx?
Er sei immer noch sehr beschäftigt „mit schlechten Schulden und Preisherabsetzen“, schreibt am 11. Dezember 1857 der Unternehmer Friedrich Engels aus Manchester an seinen Gefährten Karl Marx in London. Die Überproduktion – anfangs noch versteckt hinter „der Ausdehnung des Kredits“ – zeige sich „so allgemein“ wie noch nie. Allmählich, so die revolutionäre Hoffnung in des Fabrikanten Brust, „wird die Sache großartig“. Eine Woche später lässt Marx seinen Gönner wissen: „Ich arbeite ganz kolossal, meist bis vier Uhr morgens.“ Seine neue Ökonomie müsse nun schnell fertig werden.
Schlechte Schulden, Kreditpyramiden, Preiskämpfe, allgemeine Überproduktion – der Briefwechsel des genialen Gespanns liest sich wie ein Kommentar zum aktuellen Geschehen. Mit großem Eifer scheint sich die Wirklichkeit der Marxschen Kritik zu nähern. Und so wird neu entdeckt, was aus der Zeit gefallen schien. Allerorten blasen kahle Köpfe und ergraute Frontfrauen früherer Tage den Staub von den blauen Bänden. Manch jüngeres Aktivistenherz begibt sich auf die lange Reise des großen Werkes, von der Wertform zum Akkumulationsgesetz und hoffentlich noch weiter zu den berühmten Reproduktionsschemata der zweiten und zu den Erscheinungsformen des Mehrwerts in der dritten Etappe.
„Das Kapital lesen“ ist im akademischen Winter zum Renner geworden. Möge die Kraft bei möglichst vielen reichen bis zum Schluss, der dann vielleicht ein Anfang ist – für das eine oder andere Talent, das nah am Puls der Geschäftswelt, im vollen Bewusstsein ökologischer Grenzen und unermüdlich wie einst der Meister das gedankliche Erbe durchforstet, um den durchgeführten Begriff des heutigen Kapitalismus inklusive seiner Aufhebung hervorzubringen. Methodisch bei Marx bleiben, aber inhaltlich weit über ihn hinaus – so lautet die Aufgabe, die sich immer fühlbarer als unerledigt erweist. Allein mit flammenden Anklagen oder mit Forderungen sozialer Korrektur, wachstumsverträglicher Ressourcenschonung und intelligenter Marktkontrolle wird es nicht zu dem kräftigen geistigen Impuls kommen, der fähig ist, im Alten die Keimformen des Neuen zu erkennen und sie als tragfähiges Konzept zu formulieren.
Für die heute am Pranger stehenden Neoliberalen hat ihr konsequentester Ahnherr 1949 beschrieben, worum es für ihn und seinesgleichen damals ging. Als der Zeitgeist noch sozialistisch war und niemand die spätere liberale Renaissance für denkbar hielt, ermahnte Friedrich August von Hayek sein bürgerliches Publikum, sich der eigentlichen Stärke seiner Gegner zu stellen: „Die wichtigste Lektion, die der wahre Liberale vom Erfolg der Sozialisten lernen muss, besteht darin, dass es ihr Mut zur Utopie war, der ihnen die Unterstützung der Intellektuellen sicherte und dadurch einen Einfluss auf die öffentliche Meinung, der tagtäglich möglich macht, was noch vor kurzem als unerreichbar galt. … Daraus folgt: Wir müssen es schaffen, die philosophischen Grundlagen einer freien Gesellschaft erneut zu einer spannenden intellektuellen Angelegenheit zu machen, und wir müssen ihre Verwirklichung als Aufgabe benennen, von der sich die fähigsten und kreativsten Köpfe herausgefordert fühlen. Wenn wir diesen Glauben an die Macht der Ideen zurückgewinnen, der die Stärke des Liberalismus in seinen besten Zeiten war, dann ist der Kampf nicht verloren.“
Vertauscht man in Hayeks Aufsatz die Rollen und aktualisiert die geistige Front, lautet der dringende Appell: Gegen die Utopien des Marktes und der individuellen Nutzenmaximierung sind die Grundlagen einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft zu einem Thema zu machen, von dem sich die besten kritischen Geister angesprochen fühlen. So weit ist es offensichtlich noch lange nicht. Moralische Entrüstung und der dienstbeflissene Austausch über die Richtigkeit dieses oder jenes Instruments aus dem politischen Handwerkskasten beherrschen die Szene. Obwohl die Wall Street zusammengebrochen ist, die Rezession in eine Depression mündet und der Planet angesichts seiner Vergewaltigung zu rebellieren beginnt, bleibt der reformatorische Diskurs erstaunlich zahm. Wie ist es möglich, dass angesichts einer noch nie dagewesenen wechselseitigen Abhängigkeit aller Teile dieser Welt der individuelle Nutzenmaximierer und der blinde Markt noch immer und trotz aller Blamage zum Ideal erklärt werden? Warum ist im Moment eine Kraft undenkbar, die sich analog zur Bürger- oder Arbeiterbewegung früherer Jahrhunderte um ein gemeinsames Interesse gruppiert? Ist die heutige Gesellschaft so ausdifferenziert, dass in ihren Elementen alles erdenklich Neue, aber im Ganzen nichts wirklich Anderes mehr geht? Weshalb ist in einer Zeit, in der Wissenschaftler und Techniker im Verhältnis zur Natur eine Revolution an die andere reihen, die gesellschaftliche Phantasie so erstarrt?
Diese Verlegenheit muss fundamentale Gründe haben. Am wichtigsten ist wohl die Denkblockade der Denker, ihre Unfähigkeit zu integrieren, was zusammen gehört. Seit Jahrhunderten daran gewöhnt, die Natur bestenfalls als zu beachtende Umwelt, aber nicht als Basis von allem zu denken, bleiben die Analysen wie die Empfehlungen naturblind und stoffvergessen. Was bei Marx angelegt ist, aber zu seiner Zeit noch wirklich nicht zu denken war, kam auch später im Sinne einer durch und durch ökologischen und gleichzeitigen politiktauglichen Vision niemals aufs Papier. Das gilt besonders für die Ökonomen, die – ob in linken oder rechten Varianten – noch immer glauben, dass Wachstum niemals sinnlos sein kann. In ehrlichen Bilanzen, bei voller Berücksichtigung aller gesellschaftlichen und ökologischen Folgen, sind aber schon heute die Kosten des vermeintlichen Fortschritts oft höher als sein Nutzen. Anti-ökonomisches Wachstum nennt das der Amerikaner Herman Daly und verlangt zu Recht, dass die Reproduktionsfähigkeit der Natur zum Ausgangspunkt aller ökonomischen Modelle wird.
Wer das beherzigt, sieht die soziale Frage in einem neuen Licht. Es geht dann nicht nur um Verteilungsgerechtigkeit herkömmlicher Art, sondern um garantierte Lebenschancen, die möglichst viele Menschen zu einem neuen Kurs ermutigen. Ökologisch formuliert, erscheint die soziale Frage erst in ihrer ganzen Dimension. Die heutigen Denker, die Ökonomen wiederum an erster Stelle, versagen nicht nur defensiv, bei der Gefahrenabwehr, sondern auch offensiv. Verborgene Chancen der Produktivkraftentwicklung kommen mit traditionellen Modellen nicht ins Visier. Beispielsweise ist all dem, was Wissenschaft, Kunst und Kultur hervorbringen, den Produkten des Geistes also, die Tendenz zum freien, öffentlichen Gut immanent. An vielen Fronten, ob in der Musik oder bei den Informatikern, erweist sich die private, verwertungsabhängige Form als nicht mehr adäquat. Es geht also nicht nur um die Verhinderung von Auswüchsen, um die Eindämmung von Negativtrends, sondern auch um das Wachküssen ungenutzter Möglichkeiten. Der Geist, der im Zeitalter seiner nahezu kostenlosen technischen Reproduzierbarkeit unmittelbar zum Welterbe werden kann, sollte nicht in seiner privatwirtschaftlichen Begrenzung und im klientelistischen Dünkel stecken bleiben. Man muss sich also fragen, wie der technische, wissenschaftliche und künstlerische Genius sinnvoller, freier und zugänglicher zur Entfaltung kommt, ohne die Antriebskräfte für seine Produktion zu erlahmen.
Wir brauchen also neben der „Erdung“ der Ökonomie auch zeitgemäße Modelle geistiger Produktion. Wie groß angesichts der Herausforderungen der gedankliche Mangel ist, zeigt unmissverständlich das gegenwärtige Angebot im politiknahen intellektuellen Warenhaus. Mit welchen Mitteln die ökologische Gefahr zu meistern ist und wie die wirtschaftlichen Verhältnisse umzugestalten sind, bleibt ein Rätsel. Politik ist wie gehabt die späte Erscheinung einer frühen Idee, und Politiker sind Gefangene ihres begrenzten Handlungsraums. Fehlt der Vorlauf, geht es munter weiter auf ausgetretenen Pfaden. Auch wenn die blauen Bände in grüner Schrift noch nicht zu haben sind, ist eine Schlussfolgerung aus der gegenwärtigen Doppelkrise von Weltwirtschaft und Weltökologie wohl erlaubt. Die Basis des gesellschaftlichen Lebens wie Energie, natürliche Ressourcen, Gesundheit und Bildung gehören ebenso wenig ins Verwertungskalkül wie die Lebensnerven des Austauschs. Für das Geldwesen ist dieser Gedanke schon nicht mehr abwegig, für die restliche Welt des Geistes immer noch kühn.
Aber manchmal geht es schneller als erwartet. Unter dem Titel Mission possible habe ich am 20. Februar 2004 in dieser Zeitung ein 480-Milliarden-Programm gefordert – als Schmiermittel für einen kräftigen sozialökologischen Umbau. Leider können die Staatssekretäre von Merkel und Steinbrück nicht gründlich lesen. Die Summe haben sie exakt übernommen, aber allein für die Banken reserviert. So bitte nicht. Kein Betrug beim Plagiat. Nicht Bürgschaften für die Zocker, nicht Schutz der Eigentumstitel, sondern Investitionen in eine bessere Welt.
erschienen im >Freitag> 50 11.12.2008