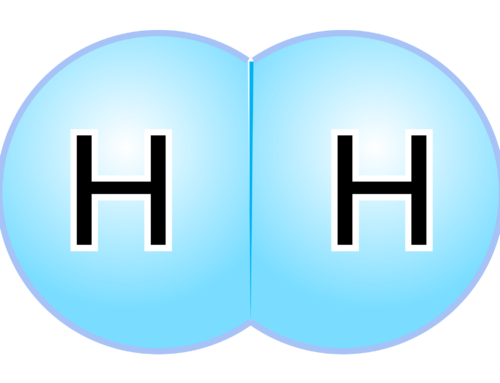Wagen wir zu Beginn ein kleines Stück konkreter Utopie. In Wien tagt der Weltfinanzkrisengipfel. Präsidenten, Kanzlerinnen und Regierungschefs erklären zum Abschluss, was das gewöhnliche Volk schon lange weiß, aber aus offiziellem Munde noch nie zu hören war:
»Kreditderivate kann man nicht essen. Optionsscheine löschen keinen Durst. Die gesamte Finanzwelt hat keinerlei unmittelbaren Gebrauchswert. Sie ist bestenfalls Mittel zum Zwecke rationaler Ressourcenlenkung. Insofern muss auch das Geldwesen inklusive aller Zweige des Investmentbankings einem simplen Nützlichkeitstest unterliegen. Ist das Mittel dem Zweck dienlich? Wird es richtig und effizient eingesetzt?
Nach schmerzlichen Erfahrungen sagen wir Nein. Die heutige Banken- und Börsenwelt ist irrational und eine Last für die Volkswirtschaften. Und sie handelt verbrecherisch. Fonds, die mit Nahrungsmitteln jonglieren, stillen nur den Profithunger und lassen Millionen Menschen sterben. Nicht nur starke Regulation, sondern auch Schrumpfung ist das Gebot der Stunde. Wir werden den Dschungel der Finanzinstrumente lichten – nicht mit folgenlosen Appellen, sondern mit Verboten.
Gleichzeitig stärken wir das Gemeinwohl als lenkende Instanz. Was und wie zu produzieren ist – das sollen nicht länger die mächtigen Spieler entscheiden. Wir wollen eine neues Kapitel der Demokratie aufschlagen: nicht über alle Einzelheiten, wohl aber über die großen Linien der Wirtschaft soll das Volk bestimmen. Die Raubzüge gegen Mensch und Natur, orientiert an kurzfristigem Profit, wollen wir beenden. Statt gnadenlosem Wettbewerb, schreiender Ungleichheit und blinden Märkten erklären wir Kooperation, Gleichheit und vorsorgende Planung zu unseren neuen Leitprinzipien.«
Noch ist diese Wiener Deklaration Utopie. Solche radikal klingenden, aber eigentlich naheliegenden Einsichten sind leider nicht der Ausgangspunkt des wieder aufkeimenden Interesses an Industrie- und Strukturpolitik. Der Schrecken über die Idiotien und die Verbrechen marodierender Finanzbosse ist noch spürbar. Aber in Politik und Medien erklingt längst wieder die alte Melodie: Die Staaten selbst sind es, die nicht mit Geld umgehen können. Und so kam es in Europa zu dem, was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Die Europäische Gemeinschaft verkommt zur Finanzdiktatur der einen über die anderen – und im Hintergrund sind es die geretteten Banken, die ihren Rettern, den Staaten, die Bedingungen ihrer Rettung ins Gesetz schreiben.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass die fällige Umkehr höchstens eine kleine Abkehr zu werden verspricht. Etwas weniger verrückte Finanzmärkte, etwas weniger Vertrauen in fragwürdige Dienstleistungen, im Gegenzug mehr reale Güterproduktion und mehr echte statt papierne Wertschöpfung. Das ist der dürftige Gehalt aktueller Debatten über eine Renaissance der Industriepolitik. Wenn diese vermeintliche Renaissance tatsächlich im Sinne von Zukunftssicherung wirken soll, dann müsste sie sich auf die fundamentalen sozialen und ökologischen Herausforderungen konzentrieren, deren Vorboten bereits signalisieren, dass es künftig um eine andere Wirtschaftsweise gehen muss.
Auf dem Weg dahin ist »mehr Industrie« eine falsche Botschaft. Stattdessen sollte es um volkswirtschaftliche Strukturen gehen, die den ökologischen Imperativen entsprechen und allen Bürgerinnen und Bürgern die möglichst angstfreie Umkehr ermöglichen. Ist das denkbar? Gibt es Anknüpfungspunkte für eine solche Politik, die nicht der Logik des Wettbewerbs, sondern den Zielen eines sozialen und ökologischen Umbaus folgt?
Strukturpolitik findet jeden Tag statt. Nur trägt sie diesen Namen nicht. Die gesamte Automobilindustrie hängt davon ab, dass die Infrastruktur des Verkehrs autogerecht gestaltet wird. Alle Wirtschaftszweige brauchen in irgendeiner Weise verlässliche Standards, die nur politisch zu gewährleisten sind. Deshalb ist die von den Liberalen gepriesene Souveränität der Produzenten und Konsumenten in einer hochgradig vergesellschafteten Wirtschaft immer eine Scheinsouveränität. Was bei kleinen und mittleren Unternehmen als Souveränität erscheint, ist in den meisten Fällen pure Abhängigkeit von großen Konzernen, deren Bedarf die Wirtschafts- und Strukturpolitik weitgehend bestimmt. Letztlich ist damit auch für die Konsumenten das Spektrum der Optionen beschränkt.
Alles in Wirtschaft und Politik ist heute durchzogen von Erwartungen für die Zukunft und Reaktionen darauf. Es gibt eine zunehmende Verflechtung nicht nur in der Sache und territorial, sondern auch temporal. Das gilt nicht nur, aber vor allem für den Stoffwechsel mit der Natur. Grenzen für Schadstoffe und Engpässe bei den Rohstoffen verlangen heute schon Strategien, auch wenn sie erst übermorgen zu spüren sein werden. Für Planungsstäbe heißt das Vorwärtsverteidigung in der Zeit gemäß den Interessen ihrer jeweiligen Organisation.
Der neue Hang zu strategischem Handeln ist kein Garant für ökologische Rationalität. Auch hier gilt: Cui bono? Wer entscheidet in wessen Interesse? Wer erhält Planungssicherheit und wer nicht? Wird der Rohstoffbezug der nationalen Industrie geplant oder eine Wirtschaftsstruktur, die ihren Energie- und Ressourcenverbrauch drastisch reduziert? Werden die jeweiligen Champions planerisch begleitet, wie in Deutschland etwa die Autoindustrie, oder kommen neue ökologische Verkehrssysteme zum Zuge, in deren Zentrum öffentliche Anbieter stehen?
Die Renaissance der Strukturplanung ist kein emanzipatorischer Selbstläufer, aber eine Einladung ist sie allemal. Erstmals seit Jahrzehnten ist ein Politikfeld wieder offen, das von Marktrhetorik verbarrikadiert worden war: die bewusste, begründungs-und rechenschaftspflichtige Beeinflussung sektoraler Entwicklung. Der Finanzsektor und die Energieversorgung sind die aktuellen Beispiele, die sich einem breiten Diskurs über das »Wozu« und »Wohin« nicht mehr entziehen können.
Gemessen am ökologisch Notwendigen stehen aber nicht nur diese beiden, aktuell umkämpften Branchen im Fokus, sondern die gesamte Wirtschaftsweise. Es geht nicht mehr nur um einzelne Schadstoffe, die zu begrenzen, um einzelne Naturräume, die zu schützen sind. Heute geht es um die Ökologisierung der Wirtschaftskreisläufe insgesamt, um das Primat der Ökologie, um den Naturerhalt als oberstes Prinzip.
Das ist für alle eine fundamentale Herausforderung – nicht nur für die bürgerliche Auffassung einer untertänigen Natur, sondern auch für ihren Gegenpol. Auch für Gewerkschaften und Arbeiterbewegung ist die Beherrschung der Natur, die ständige Entwicklung der Produktivkräfte, der kaum hinterfragte Motor der Geschichte geblieben. Irgendwann, so die Überzeugung zumindest des linken Teils der organisierten Lohnarbeit, werde diese Kraft so stark, dass sie nicht mehr mit privatwirtschaftlichem Dünkel, sondern nur noch mit gesellschaftlichem Eigentum bewältigt und weiter vorangetrieben werden könne.
Bertolt Brecht konnte noch behaupten, dass die Realität in die Funktionale gerutscht sei. Ob der Hammer der Kunst dient oder zum Werkzeug des Mordes wird, sei dem unschuldigen Hammer nicht anzusehen, sondern nur der ihm vom Menschen zugedachten Funktion zu entnehmen. Heute wissen wir, dass zwar viele Wahrheiten noch immer in der Funktionalen stecken, dass aber gleichzeitig die Wahrheit auch in die Materiale, in die Energie- und Stoffkreisläufe, gerutscht ist. Selbst alltäglicher Konsum ist dem Verdacht des »zu viel«, »zu giftig« und »unverantwortlich« ausgesetzt. Und die Produktion, die dahinter steckt, erscheint wie eine Maschinerie, die bei allem Nützlichen, das sie hervorbringt, eben auch die Lebensgrundlagen zerstört.
In den Hochzeiten der Arbeiterbewegung war Planung das Instrument, um die Wahrheit in eine neue Funktionale zu bringen, damit – um im Bild zu bleiben – der Hammer allein den Menschen diene und nicht dem Akkumulationstrieb des Kapitals. Nachdem dieser Versuch mit dem Hammer (und der Sichel) in Osteuropa schief gegangen ist, traut sich kaum jemand, von Planung als neuer Notwendigkeit zu sprechen. Tatsächlich aber hat sich volkswirtschaftliche Planung längst wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Nur mit umgekehrtem Ziel: nicht maximale Naturunterwerfung, sondern Einhaltung von Grenzen und Reduktion unhaltbaren Naturverbrauchs.
Bislang beziehen sich Reduktionspolitiken nur auf Schadstoffe. Ziel ist die Senkung der Abfallmengen, die sich in den Umweltmedien einlagern und zerstörend wirken. Schon diese Aufgabe verlangt nicht nur mehr Planung, sondern auch eine andere Art von Planung. Es geht nicht mehr um die Rahmenbedingungen, die für eine maximale Steigerung der in Geld ausgedrückten Mengen des Reichtums sorgen, sondern um Anreize, die zu einer Senkung der in physikalischen Größen gemessenen Stoffe beitragen müssen.
Die bisher angewandten Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, sind vorrangig konzentriert auf End-of-Pipe-Technologien (Entschwefelung von Rauchgasen oder Partikelfilter für Autoabgase) und Effizienzsteigerungen (weniger Rohstoff- und damit Naturverbrauch je Nutzeneinheit). Selten geblieben ist die ganzheitliche Gestaltung von Stoffkreisläufen mit Wiedereingliederung und Mehrfachnutzung.
Die vertane Zeit lässt die Aufgaben wachsen. Künftig wird sich Reduktionspolitik nicht nur auf Schadstoffe beziehen müssen, nicht nur auf die Reduktion der in Luft, Böden und Gewässern deponierten Abfälle. Es wird auch nicht reichen, Produkte mit immer raffinierteren und effizienteren Methoden herzustellen. Es geht vielmehr um den Ursprung der Probleme, um die Quelle, mithin den Umfang der Naturnutzung selbst.
Bislang ist noch schwer vorstellbar, wie maximale Mengen für Rohstoffe festgelegt und durchgesetzt werden könnten. Völlig absurd aber ist der Gedanke nicht. Denn zumindest in einer Branche passiert genau das. Die Senkung des Energieverbrauchs ist offiziell verkündetes Ziel. Folglich sollte die Angst vor der argumentativen Keule »Planwirtschaft« die Angriffslust nicht trüben.
Reduktionspolitik wird auch andere Branchen erfassen müssen und kann dabei mit erheblicher Unterstützung der Bevölkerung rechnen. Weniger Verkehr, weniger Fleischkonsum, weniger Massentierhaltung – solche Forderungen sind bereits populär. Dieses »Weniger« ist – im Unterschied zu einzelnen Gefahrstoffen, die sich mit Ordnungspolitik, also mit Geboten und Verboten regeln lassen – einerseits ein Gegenstand für Kampagnen und Aufklärung, andererseits aber auch ein Planungsthema. Denn die Neuausrichtung ganzer Branchen verlangt, ob im Verkehrssektor oder anderswo, langfristige Planung, wie selbst konservative Regierungen unfreiwillig konstatieren, wenn sie Energiekonzepte mit dem Planungshorizont von 40 Jahren oder Strategien für die Sicherung von Rohstoffen vorlegen. Dieser langfristig planenden Strukturpolitik die Einseitigkeit zu nehmen, sie zu demokratisieren, zu verbreitern und zu systematisieren – darauf kommt es an.
Noch sind die Hürden für demokratische Planungsprozesse im Bürgerinteresse hoch und zahlreich. Planungsstäbe agieren weitgehend im Verborgenen. Verträge zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen sind selbst den Parlamenten kaum zugänglich. Gesetzentwürfe werden bisweilen an private Kanzleien outgesourct. Die Beziehungen zwischen einflussreichen Abgeordneten und Wirtschaftsverbänden sind eng und vertraulich. Das Öffentliche ist bislang nicht das, was es sein sollte: kompromisslos öffentlich.
Aber es ändert sich einiges. Unsinnige Großprojekte stoßen auf massiven Widerstand. Die Bürgerschaft nutzt ihre oft überlegenen Sachkenntnisse, um nicht nur mitsprechen, sondern auch entscheiden zu können. Direkte Demokratie ist populär. In den vergangenen Jahren sind Volksbegehren und Bürgerentscheide gestartet worden, die das politische System unter Druck und Rechtfertigungszwang setzen. In Berlin mussten die Geheimverträge der Wasserprivatisierung veröffentlicht werden, weil erstmals eine von Aktivistinnen und Aktivisten selbst formulierte und von der Bevölkerung unterstützte Initiative zum gültigen Landesgesetz wurde. Es bedarf keiner überbordenden Phantasie, um sich vorzustellen, wie aus der formellen, auf die Stimmabgabe beschränkten und allzu oft den Willen der Bevölkerung ins Gegenteil verkehrenden Schein-Demokratie eine lebendige Demokratie wird, die ihrem Begriff, Herrschaft des Volkes, deutlich näher kommt.
Auf übersichtlich gestalteten Internetseiten würden alle entscheidungsrelevanten Informationen bereit stehen. Kein Bürokrat könnte mehr im Trüben fischen, und der Verschwender stände schnell am Pranger. Geheimverträge gäbe es nicht mehr. Die Bevölkerung hätte weitreichende Klage- und Initiativrechte. Auf der kommunalen Ebene könnte es neue Organe geben, nicht nur Beiräte, sondern auch Räte, die problemnah, in direktem Kontakt mit den Betroffenen und auf der Basis eines imperativen Mandats Entscheidungen treffen. So würde das Öffentliche tatsächlich öffentlich werden, und der Demos hätte tatsächliche Entscheidungsgewalt. Karl Marx würde sich im Grabe freuen: »Die Freiheit besteht darin, den Staat aus einem der Gesellschaft‘ übergeordneten in ein ihr durchaus untergeordnetes Organ zu verwandeln.“
Wäre die Demokratie tatsächlich das, was sie vorgibt zu sein, könnten neben Infrastrukturen auch Wirtschaftsstrukturen allmählich in den Blick kommen. Dann ginge es nicht nur um Wasserversorgung, S-Bahn-Betriebe und andere Bereiche der Daseinsvorsorge, sondern auch um Kernbereiche der Privatwirtschaft. Für diese Erweiterung gibt es eine sehr handfeste Begründung. Attraktive Optionen für mehr Lebensqualität bei deutlich reduziertem Ressourcenverbrauch wird es nur geben, wenn sie systemisch angelegt sind. Solche Optionen können Märkte prinzipiell nicht zur Verfügung stellen.
Die Privatwirtschaft kann singuläre Öko-Effizienz hervorbringen, aber keine systematische. Verbrauchsarme Autos, aber keine effizienten Verkehrssysteme. Öko-Häuser, aber keine ökologisch sinnvollen Siedlungsstrukturen. Effiziente Heizungen und Elektrogeräte, aber keine nachhaltigen Energiesysteme. Bio-Lebensmittel, aber keine Bio-Agrarsysteme. Große ökologische Effekte sind nur dann zu erzielen, wenn man nicht nur auf einzelne grüne Produkte, sondern auch und vor allem auf integrierte grüne Systeme setzt.
Diese ökologischen Aufgaben verlangen – wenn sie nicht gegen die Bevölkerung, sondern mit ihr auf den Weg kommen sollen – egalitäre Antworten: Einkommensgarantien für die vom Wandel negativ Betroffenen, massive Umverteilung von Einkommen und Arbeit, drastische Korrektur der Vermögensverhältnisse und Aufbau von Belegschaftseigentum in den Unternehmen, Ausbau des öffentlichen Sektors. Diese harten Einschnitte in tradierte Eigentumsverhältnisse sind, wenn der ökologische Umbau zivilisiert gelingen soll, auf Dauer unvermeidbar. Sie sind nicht zuletzt ein Mittel, um Produktivitätsgewinne in mehr Muße, mehr Freizeit, mehr Freiheit zu verwandeln. Die Wiener Deklaration könnte – wenn es zu diesem Aufbruch käme – Wirklichkeit werden.
Nähere Ausführungen zu den Gedanken dieses Textes sind zu finden in: (Thie, Hans (2013). Rotes Grün. Pioniere und Prinzipien einer ökologischen Gesellschaft. Hamburg: VSA-Verlag. Kostenloser Download: www.rosalux.de/publication/39552.
Erschienen in: Kurswechsel 3 / 2013: 87–91 www.kurswechsel.at