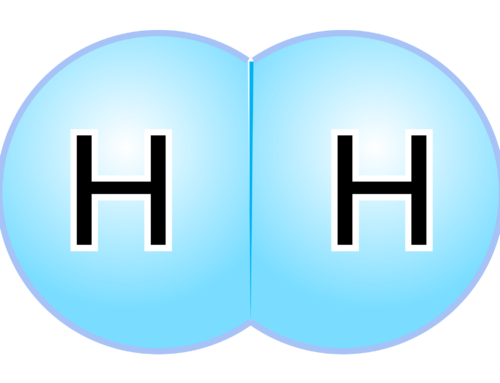Grenzen der Zumutbarkeit: Was sich in Deutschland an Wut und Ohnmacht gestaut hat, braucht endlich ein französisches Ventil
In Frankreich haben die herrschenden Kreise einen großen Vorteil, den sie allerdings kaum zu schätzen wissen. Wenn sie den Bogen überspannen, erfahren sie das unmittelbar und öffentlich. Sie müssen nicht erst bis zum Ende der Sackgasse rennen, um zu erkennen, dass sie eine ist. So bleiben frühzeitig Gesetze auf der Strecke, die nur Unheil anrichten würden, weil man sie mehrheitlich als würdelos, falsch oder ungerecht empfindet.
Bei uns in Deutschland sind die Empfindungen ähnlich, aber die Reaktionen ganz anders. Wie jede seriöse Umfrage zeigt, spüren auch die Deutschen genau, dass permanent Grenzen zumutbarer Unterschiede der Einkommen, der Vermögen und der Lebenschancen überschritten werden, aber ihr Widerstand bleibt – von Verbandsprotesten einmal abgesehen – fast immer individuell und passiv.
Drüben der Aufruhr – hier die gespenstische Stille. Achselzuckend steht man vor der Differenz zwischen Franzosen und Deutschen und kann nur auf bessere, bewegtere Zeiten hoffen. Aber werden sie jemals kommen, wenn zwischenzeitlich die Irrwege der herrschenden Politik immer weiter beschritten werden? Irgendwann sind die Spätfolgen des seit Jahren anhaltenden Kürzens und Streichens nicht mehr auf rationale Weise zu beheben. Wie sich Armut, Ausgrenzung und Bildungsmangel zu völliger Perspektivlosigkeit verdichten, ist in deutschen Großstädten schon heute nicht mehr zu übersehen. Was die Bilder aus der Berliner Rütli-Schule illustrieren, bestätigt die Statistik eindrucksvoll: In der deutschen Hauptstadt wachsen 34 Prozent aller Kinder unter 15 Jahren in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften auf. Sie erleben jeden Tag am eigenen Leib und durch ihre Eltern, was es heißt, von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen zu sein – eine Erfahrung, die in den ostdeutschen Provinzen mittlerweile jeder dritte Erwachsene kennt und die in westdeutschen Kommunen längst nicht mehr unbekannt ist.
Ausgrenzung wäre ein Generalthema der Bundesrepublik, würde es aus dem Munde der Betroffenen selbst zur Sprache gebracht. Solange sie schweigen, kennt die Politik keine Gnade und verfährt nach den bekannten Mustern. So wird Hartz IV, das einschneidendste Gesetz der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte, nahezu ohne öffentliche Diskussion verschärft, um seine Kosten zu senken. Schnüffelei statt kritischer Bilanzierung der gesellschaftlichen Folgen – die Beamten des Bundesarbeitsministeriums hatten offenbar alle Freiheiten, den Vollzug von Hartz IV härter zu reglementieren, und wurden von rechtlichen Bedenken nicht behelligt. Um so behutsamer geht man mit der Reichensteuer um, die ohnehin nur ein Placebo für sozialdemokratische Wähler ist. Dass jenseits dieses symbolischen Aktes Kapital und Vermögen steuerlich so herangezogen werden, wie es in anderen Industrieländern üblich ist, scheint im Augenblick unvorstellbar.
Die Haltung, die eine merkwürdig einseitige und folgenblinde Politik immer wieder begründet und das gesamte Establishment eint, könnte man bürgerlichen Stalinismus nennen: Es gibt nur einen einzigen Weg, und der ist vorherbestimmt. Zu dieser armseligen geistigen Lage der Nation haben viele beigetragen, als Werbeträger gekaufte Fernsehmoderatoren ebenso wie scheinbar unabhängige Professoren, die im Sold von Versicherungsunternehmen stehen. Dank Albrecht Müllers Buch Machtwahn wissen wir inzwischen, dass sich Konzerninteressen gern als nüchtern vorgetragene Expertise verkleiden.
Die weitaus größere Schuld trifft allerdings die Ex-Sozialisten und Ex-Maoisten, die in Ministerrang und Kanzleramt bis vor kurzem das Land regiert haben. Vor 30, 35 Jahren, als ausgerechnet in der kleinen, niedlichen und so wunderbar machtlosen Bundesrepublik das Anti-System-Denken seinen Höhepunkt erreichte, als die Arbeitslosigkeit nahe bei Null lag, die Reallöhne jährlich um fast zehn Prozent stiegen, neue Hochschulen aus dem Boden schossen und von leeren Kassen noch keine Rede war, lobten sie die Vorbilder China, Albanien oder Sowjetunion und forderten als konkrete Utopie doch wenigstens die umgehende Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien.
Heute haben sich die politischen Kampffronten auf groteske Weise verkehrt. Nicht alle, aber auffallend viele der Radikalen von damals sind mittlerweile willfährige Vollstrecker des Systems, das sie damals verteufelten. Und nicht nur das: Weil sie sich beim Prinzipiellen – beim ganz oder gar nicht – offenbar immer noch wohl fühlen, haben sie, auf der anderen Seite der Barrikade angekommen, kein Verständnis für die Gestaltungschancen, die es innerhalb des bürgerlichen Gesellschaftskorsetts immer noch gibt. Bar jeder Vernunft und blind dem Standortwahn folgend, haben sie den Herren, die sie früher „das Kapital“ nannten, zig Milliarden Euro geschenkt, im Gegenzug Städte und Gemeinden ruiniert und mit der Agenda 2010 die früher so geliebten Proleten ins Abseits gedrängt. Für sie war und ist Politik persönliches Machtgeschäft, bar jeden Ziels und permanent schwankend zwischen Nachrichtenstand und Kassenlage.
Auf der anderen Seite sind von denen, die man damals Spießbürger nannte, vom stinknormalen Volk also, zunehmend radikale Töne zu vernehmen: „So kann es nicht weiter gehen“ – „Irgendetwas muss sich grundlegend ändern“ – „Dieses ganze System haut nicht mehr hin“. Nur, was nützt dieses hilflose private Entsetzen, wenn es außer bei Linken und Gewerkschaften keinen Resonanzboden findet? Der große Frust, der sich in Deutschland angestaut hat und in jedem Alltagsgespräch zu hören ist, braucht endlich ein französisches Ventil.