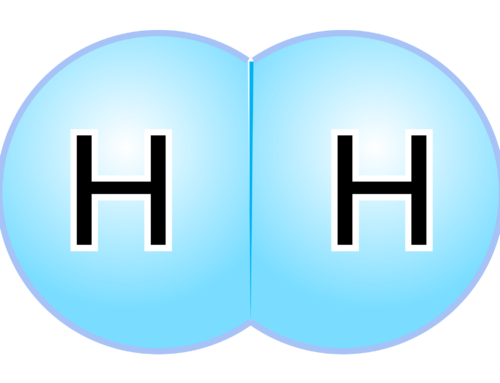Dezember 2020
___________________________________
»Meine Herren, wir bauen keine Autos mehr.« Das verkündete US-Präsident Franklin D. Roosevelt den ungläubigen Chefs von Ford, Chrysler und General Motors im Dezember 1941. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor brauche Amerika die riesigen Produktionshallen in Detroit für die Massenproduktion von Bombern und Geschützen.
Was damals der Krieg gegen den japanischen und deutschen Faschismus war, ist heute der Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe. »Meine Damen und Herren, wir verbrennen nicht mehr Öl, Gas und Kohle. Mit dem größtmöglichen Tempo steigen wir aus und vervielfachen unsere Investitionen in Wind, Sonne und Speicher, in saubere Verkehrssysteme, in emissionsfreie Gebäude und in Wasserstoff für eine klimaneutrale Industrie.« Diese selbstbewusste Haltung einer imaginären Kanzlerin wäre nötig, wenn das Pariser Klimaabkommen tatsächlich gelten soll. Damit den fossilen Interessen und ihren Finanziers klar wird, was die Stunde geschlagen hat, würde sie ergänzen: »Wir werden so mutig sein wie einst Roosevelt mit seinem New Deal. Mehr Gemeinwirtschaft, die öffentliche Hand als strategischer Investor, Ermutigung für unsere Communities, straffe Regeln für die Banken, Steuersätze für die Superreichen nahe 100 Prozent – all das brauchen wir auch heute.«
Amerikas Realität vergangener Tage klingt wie eine ferne Utopie. Deshalb bleibt einstweilen nur der mühsame Weg, den fossilen Wahnsinn mit Bewegungen und Kampagnen zu attackieren und die Regierungen zur ökologischen Vernunft zu zwingen. Wie wird dabei das gemeine Volk zum Partner der Aktivistinnen und Aktivisten? Dieses Rätsel ist bislang ungelöst. Umbau der Industriegesellschaft heißt auch Wegfall von hunderttausenden Arbeitsplätzen, häufig in regionaler Konzentration. Dass gleichzeitig neue Jobs entstehen, ist für die aufkommende Wut ein schwacher Trost. Wenn dann noch der typische Öko-Talk und die rechthaberische Verzichtslyrik hinzukommen, wird der vermeintliche Aufklärer schnell zum Feind des getretenen Strukturwandel-Opfers. Das zeigt sich nun auch im Westen, in Stuttgart, Wolfsburg und anderswo. Der Osten kennt das schon lange.
Schnell wieder Jobs, egal welche
Nachdem das morsche DDR-Gebäude im Herbst 1989 zerfallen war, gab es in der aufgewühlten Reform-Republik eine kurze, aber intensive Zeit des Aufbruchs, der Ideen, des individuellen und kollektiven Veränderungswillens. Demokratie, Selbstbestimmung, Eigenständigkeit der Betriebe und Reisefreiheit waren die Zentralthemen, aber die Bewahrung der Natur gehörte auch prominent dazu. Hätte es damals schon den Green New Deal als zusammenfassenden Namen für den reformatorischen Eifer gegeben, er hätte gepasst.
Aber dann kam die ersehnte D-Mark, die sich schnell als Industrie-Guillotine erwies. Die Treuhand verschleuderte an die westlichen Stiefbrüder, was übrigblieb. Der fatale Grundsatz »Rückgabe vor Entschädigung« begünstigte die im Westen sitzenden Alteigentümer, brachte eigentumsrechtliches Chaos und lähmte die Investitionen in Ostdeutschland.
Das Freiheitsversprechen der Einheit war schön und real. Aber der Industrie-Shutdown war auch real, nur leider nicht schön. Im Wochenrhythmus wurden Großbetriebe geschlossen, Leben entwertet. Die mentalen Langzeitfolgen sind immer noch spürbar: Wut, Zynismus, Depression, Sprachlosigkeit zwischen Ost und West. Zeichen des Aufbegehrens wie die Hallenser Eier-Attacke auf Helmut Kohl im Mai 1991 oder zwei Jahre später der Hungerstreik der Kali-Kumpel von Bischofferode blieben leider Episoden. Schnell wieder Jobs, egal welche – das war die Parole. Kein Wunder, denn in manchen Orten lebte die Hälfte der Menschen von Arbeitslosenstütze und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Für Luft, Gewässer, Gesundheit und deutsche Klimabilanz war die Einheit ein großer Gewinn. Massenhaft wurde saniert, dreckige Produktion gestoppt. Die Städte wurden schöner, die Straßen besser und die Züge schneller. Mit viel öffentlichem Geld lockte man die privaten Investitionen. Dresden, Jena, Leipzig und Potsdam robbten sich langsam an westdeutsches Niveau heran.
Kreative Experimente alternativer, auch ökologischer Geldverwendung wurden allerdings nicht toleriert. Und wenn doch einmal ein lokaler Mandatsträger es wagte, Gesetze zu dehnen und Bestimmungen zu umgehen, die einfach nicht passten, waren schnell jene West-Gesandten mit »Buschprämie« zur Stelle, die für die überfällige Belehrung sorgten. Die Folgen waren um die Jahrtausendwende überall zu besichtigen: Gehwege nach DIN-Norm, aber kaum noch Einwohner. Aufwendige Haltestellen ohne Buslinien. Voll erschlossene Gewerbegebiete als beleuchtete Schafweiden. Hochregallager am Autobahnkreuz ohne jede Verflechtung mit der Region.
Der Osten hat Windflächen, der Westen investiert
Am 27. September 1998 wählten die Ostdeutschen zu 60,8 Prozent die rot-rot-grünen Parteien und schickten Helmut Kohl in Rente. Gerechtigkeit und Modernisierung mit ökologischem Touch – das kam auch im Osten an. Aber die Erwartungen wurden wieder enttäuscht. In seiner ersten Amtszeit entlastete Kanzler Schröder die Unternehmen und Vermögenden, in der zweiten präsentierte er dem Volk die Rechnung: schlechte Löhne, geringere Rente, weniger Sozialstaat, Hartz IV und Ein-Euro-Jobs.
Immerhin gab es den Geniestreich des SPD-Abgeordneten und Eurosolar-Präsidenten Hermann Scheer, der auch für den Osten zu einer Chance hätte werden können: das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), von Scheer durchs Parlament geboxt und seit dem 1. April 2000 in Kraft. Mit Preisgarantien für zwanzig Jahre, einer gesicherten Netzeinspeisung und wirksamen Innovationsanreizen lenkte das EEG die Stromerzeugung in die gewünschte Richtung. Aber das EEG hatte und hat bis heute einen regionalpolitischen Konstruktionsfehler: Windenergie an Land, die wichtigste Säule der Energiewende, sorgt kaum dort für Jobs und Einkommen, wo die Windräder stehen.
Theoretisch hätten auch die Ostdeutschen in Ökostrom investieren können. Aber ihnen fehlte das Geld oder – nach dem Wirrwarr der 1990er Jahre – der Mut. Der Osten hatte Windflächen, der Westen investierte. So flossen die Öko-Renditen genauso in die falsche Richtung wie vorher die Eigentumstitel an den ehemals Volkseigenen Betrieben. So entstand in den Weiten von Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern eine Öko-Pampa mit Disko-Effekt. Wer des Abends die Leuchtfeuer an der Nabe der Windräder sieht und weiß, dass sich mit den Karbonflügeln irgendwo weit weg auch die Kontostände drehen, der wird schnell zum Wutbürger. Landkreise, deren Ökobilanz exzellent ist, die aber ökonomisch fast nichts davon haben, sind offensichtlich nicht optimal.
Es hätte auch ganz anders kommen können. In Dänemark sind lokale Genossenschaften und Kommunen die wichtigsten Investoren. Die Renditen bleiben zu Hause. In Nordfriesland tun sich Bürgerinnen und Bürger zusammen und investieren gemeinsam. Wenn Ökologie und Finanzen Hand in Hand gehen, ändert sich auch das ästhetische Empfinden: Aus den störenden Spargeln werden grazile Säulen, die in die Zukunft weisen.
Je aktiver Städte und Gemeinden die Energiethemen selbst in die Hand nehmen, desto geringer ist die Gefahr einer nur passiven Ökologisierung, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich vor Ort die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten bilden. Ein erfolgreiches Beispiel ist die österreichische 4000-Einwohner-Stadt Güssing. Sie stand Ende der 1980er Jahre vor genau den Problemen, die später Ostdeutschland heimsuchten: Strukturschwäche, hohe Arbeitslosigkeit, Abwanderung. Zu jener Zeit begann der ÖVP-Bürgermeister Peter Vadasz mutig und weitblickend den ökonomischen Schatz der ökologischen Erneuerung zu bergen.
Mit dem vor Ort reichlich vorhandenen Holz als Universal-Rohstoff für Strom, Wärme und Kraftstoffe, mit neuen Nahwärmenetzen, mit Wind, Sonne und mit der Kommune als Unternehmer hat Güssing nicht nur seine Energieversorgung revolutioniert, sondern auch den wirtschaftlichen Turnaround geschafft. Hunderte Arbeitsplätze sind entstanden, nicht nur unmittelbare Energie-Jobs. Parketthersteller kamen nach Güssing, weil man mit dem kommunalen Heizkraftwerk Wärme-Holz-Kreisläufe zum beiderseitigen Vorteil organisieren konnte. Selbst Forschung und Entwicklung bietet die kleine Stadt in ihrem »Europäischen Zentrum für Erneuerbare Energien«.
Pilgerfahrten und gallische Dörfer
Im Oktober 2009 pilgerten 35 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Mecklenburg-Vorpommern ins El Dorado der erneuerbaren Energien, um das Modell Güssing kennenzulernen und für ihre Gemeinden zu adaptieren. Aber die Zähigkeit von Herrn Vadasz hat nicht jeder. Und in Deutschland sind den Bürgermeisterämtern enge Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung gesetzt. Nach dem Güssing-Trip ist deshalb nicht viel geschehen, obwohl gerade der Nordosten Deutschlands mit seinem Flächenreservoir und seiner hochproduktiven Landwirtschaft die Energiewende zum eigenen Vorteil selbst in die Hand nehmen könnte.
Wie man das macht, zeigt Andreas Tornow, Landwirt mit 1.600 Hektar unterm Pflug, von mächtiger Gestalt wie Obelix und scharfsinnig wie Asterix. »Ende der 1990er Jahre«, erzählt Tornow in seinem Varchentiner Hauptquartier, dem früheren Pfarrhaus, »standen wir vor einer einfachen Frage. Sehen wir weiter zu, wie unsere Dörfer allmählich sterben oder besinnen wir uns darauf, dass wir alles haben und alles können? Allein aus Varchentin mit seinen 200 Seelen flossen jährlich 300.000 D-Mark an Ölscheichs und Stromkonzerne – das war unsere erste Rechnung und Rapsöl unsere erste Antwort. Alles selbst machen, was man selbst machen kann, dabei sind wir dann geblieben, Schritt für Schritt.«
Der Zaubertrank vom eigenen Acker, in der Hofmühle selbst gepresst, speiste Tornows gesamten Maschinenpark und die Traktoren der Umgebung. Vor allem aber war das »Projekt Dieselersatz« die Initialzündung für Blockheizkraftwerke, die Strom und Wärme liefern, für einen eigenen kleinen Schlachthof, für ein Dorfrestaurant, für die Holzverwertung, für Arbeit und Einkommen, für die Überzeugung, dass regionale Kreisläufe funktionieren können. Tornows Unglück hieß Peer Steinbrück. Der damalige Bundesfinanzminister ließ 2007 die Regeln für Biokraftstoffe neu ordnen: Beimischungsquoten an der Tankstelle statt Steuerbefreiung für Rapsöl und andere alternative Antriebe. Das war das Ende für das Herzstück des Varchentiner Modells.
Was tun mit der Knete nach der Kohle?
Aktuell sind die Braunkohle-Regionen die Green-New-Deal-Labore. Im Rheinland, im Mitteldeutschen Revier und in der Lausitz wird sich zeigen, ob das geplante Auslaufen der Braunkohle-Verstromung auch der Beginn von neuen Perspektiven ist. Am Fördergeld mangelt es nicht. Bis 2038 sollen 40 Milliarden Euro fließen. Für jeden der rund 20.000 Braunkohle-Jobs gibt es zwei Millionen Euro Strukturhilfe. Was tun mit diesem Pfund? Was soll man neu aufbauen, wenn es in einem entwickelten Land kaum einen Mangel an Konsum- und Investitionsgütern gibt, wenn das ökonomische Basisproblem, das Güterangebot, praktisch erledigt ist?
Selbstverständlich wollen alle drei Reviere Defizite ihrer jeweiligen Infrastruktur beseitigen. Der Abschlussbericht der Kohle-Kommission enthält eine lange Liste: mehr Umgehungsstraßen, bessere und schnellere Bahnverbindungen, flächendeckende Digitalisierung, Technologietransfer, ein breites Spektrum von Energieprojekten. Die heute üblichen Schlagworte ökologischer Modernität fallen zwar, aber auf der Höhe der Zeit ist man trotzdem nicht. Noch immer herrscht die alte Förder-Ideologie: Kommunen und Regionen sollen sich hübsch machen und private Investitionen anlocken.
Für diesen Umweg gibt es keinen guten Grund. Städte und Regionen könnten auch selbst investieren, wenn man nicht nur in der Daseinsvorsorge (Bildung, Gesundheit, Wasser, Müll), sondern überall den dummen Grundsatz aufgeben würde, dass »privat« immer Vorrang vor »öffentlich« hat. Dem Beispiel Güssing folgend würden öffentliche Energieanbieter mit realistischen Konzepten regionaler Energieautonomie auf erneuerbarer Basis entstehen. Inspiriert von Pontevedra in Spanien oder Hasselt in Belgien wären die Innenstädte autofrei. Regionale Agrarkreisläufe, kompetentes und ökologisches Handwerk statt Wegwerfen und Neukaufen, öffentliche Online-Plattformen vernetzter Regionalwirtschaft, kommunale »Fab Labs« für die Technik-Freaks – all das ist möglich und wird längst in Europa und anderswo erfolgreich realisiert. Massenhaft brechen Pioniere mit dem Gewohnten, verwandeln Bedenken in Taten. Aktivistinnen verlassen den üblichen Pfad, probieren aus, was gestern noch waghalsig schien. Selbst manche Unternehmerinnen und Unternehmer, Landwirte und Geschäftsführungen öffentlicher Betriebe dehnen den Rahmen des Möglichen, weil sie sich ihrer ökologischen Verantwortung stellen wollen.
Initiative zurückgewinnen
Dieser moralische Impuls braucht politischen Rückenwind. Deshalb ist die Zeit reif, in Kommunalverfassungen, in Finanzierungs- und Verkehrsplänen, in Vergabe- und Energiegesetzen die vielfältigen Hindernisse für eigenständiges, kommunales Handeln zu beseitigen, die Schuldenbremse als Universalblockade abzuschaffen und massenhaft öffentliche Investitionen zu erlauben. Das EEG garantierte privaten Investorinnen und Investoren Einspeisevergütungen für zwanzig Jahre. Warum sollte diese auf einen langen Zeitraum angelegte Verlässlichkeit nicht auch für Projekte gelten, die dem Wohl aller dienen?
So könnte eine Gemeinwirtschaft mit einem mehrdimensionalen »Return on Initiative« entstehen: schnellere und kostengünstigere Energiewende, mehr Souveränität statt Abhängigkeit von externen Investoren, Stärkung der kommunalen Demokratie und der lokalen Steuerbasis. Kommunen dieser neuen Art wären weit mehr als heute wirtschaftlich handlungsbefugt und handlungsfähig. Noch besser wäre es, sie mit Bürgerentscheiden und mit dem Gebot vollständiger Transparenz zu demokratisieren. Die Kommunen wären dann nicht mehr Bittsteller gegenüber privatem Kapital, sondern selbst die dringend gesuchten Gemeinwohl-Unternehmer.
Attraktive Optionen für mehr Lebensqualität bei deutlich reduziertem Ressourcenverbrauch wird es nur geben, wenn sie systemisch angelegt sind. Solche Optionen können Märkte prinzipiell nicht bieten. Die Privatwirtschaft kann singuläre Öko-Effizienz hervorbringen, aber keine systematische. Verbrauchsarme Autos, aber keine öko-effizienten Verkehrssysteme. Öko-Häuser, aber keine ökologisch sinnvollen Siedlungsstrukturen. Effiziente Heizungen und Elektrogeräte, aber keine nachhaltigen Energiesysteme. Bio-Lebensmittel, aber keine Bio-Agrarsysteme. Große ökologische Effekte sind nur dann zu erzielen, wenn man nicht nur auf einzelne grüne Produkte, sondern auch und vor allem auf integrierte grüne Systeme setzt.
Was in Ostdeutschland längst klar auf der Hand liegt, das gilt jetzt auch für den Westen: Die neue Wirtschaft muss nicht nur »Green« sein, sondern auf einem New Deal aufbauen, also einer gerechten Neuverteilung der gesellschaftlichen Ressourcen. Das bedeutet: Garantien für die vom Wandel negativ Betroffenen, massive Umverteilung von Einkommen und Arbeit, drastische Korrektur der Vermögensverhältnisse und Ausbau des öffentlichen Sektors. Wenn angesichts ökologischer Großgefahren alles auf dem Spiel steht, darf uns keine Gewohnheit, keine Regel und keine Ordnung zu heilig sein, um sie über den Haufen zu werfen.
Mehr zum Green New Deal: Hans Thie »Rotes Grün. Pioniere und Prinzipien einer ökologischen Gesellschaft«, Hamburg: VSA Verlag, 2013
Erschienen in: JACOBIN Nr. 3 / Winter 2020