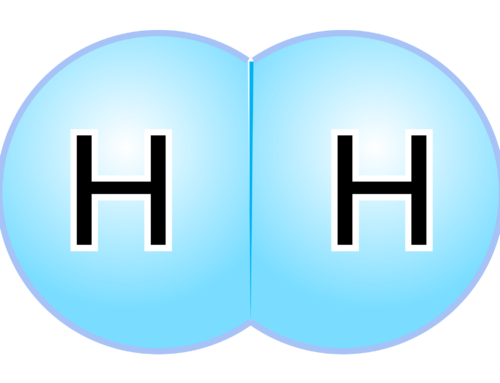Weder Bourgeois noch Citoyen: in seinem brillanten Essay „Bürger, ohne Arbeit“ springt Wolfgang Engler am Ende zu kurz, wenn er nur auf das Bürgergeld setzt
Zurück in die frühen neunziger Jahre, nicht in die deutschen des zwanzigsten Jahrhunderts, sondern in die französischen des achtzehnten. Hier, mitten im revolutionären Paris, hätte der Bürger Engler seinen Platz. Als Deputierter tritt er vor die Nationalversammlung und warnt, dass die neue Gesellschaft nicht auf halbem Wege stehen bleiben darf. Stilistisch brillant, auf den Schultern von Platon und Aristoteles, im Verein mit Rousseau und Diderot, hält er ein flammendes, mehrstündiges Plädoyer: Erst wenn, so wendet er sich an diejenigen, die es bei Liberté belassen wollen, erst wenn „soziale Rechte BEDINGUNGSLOS gewährt werden, ist der Bürger endgültig als universelles Rechtssubjekt konstituiert.“ Egalité und Fraternité unverbindlich zu proklamieren reicht nicht. Nur das ohne Ansehen von Person und Status gezahlte Grundeinkommen schafft die Synthese. Dann ist der Bürger „weder Bourgeois noch Citoyen, weder das Verträge schließende noch das politisch engagierte Subjekt, vielmehr das ihnen Zugrundeliegende, SUBJECTUM, der Mensch mit seinen vitalen Bedürfnissen, in seinem Angewiesensein und Bezogensein auf seinesgleichen.“
Wolfgang Engler war damals nicht dabei, und er lebt östlich von Rhein und Elbe. Aber eine neue konstituierende Versammlung, die so lustvoll streitet wie damals das Pariser Original, die hätte er schon gern. Nach seinen Reflexionen über Die Ostdeutschen und Die Ostdeutschen als Avantgarde widerlegt er auch mit seinem neuen Buch Walter Jens, der einmal behauptete, deutsche Intellektuelle seien unfähig, öffentlich, also begrifflich scharf und gleichzeitig pointiert, mit Effekt zu kommunizieren. Bürger, ohne Arbeit sucht sprachlich seinesgleichen und nimmt keine Rücksicht auf die schlechte deutsche Tradition, Zorn und Eifer vom Geistigen strikt zu trennen.
„Habermas has no balls“ – dieses Urteil von Anthony Giddens über gewisse Gelehrte ohne Unterleib braucht Wolfgang Engler nicht zu fürchten. Wer durch die Geschichte des Arbeitsbegriffs reisen will, dem präsentiert Engler nicht nur frühe Philosophen und ihre späte Wirkung in heutigen Diskursen, sondern auch die Zwänge des Alltags und die Verordnungen für das gemeine Volk, von denen manche, obwohl 200 Jahre alt, bis in die Formulierungen den Hartz-Gesetzen gleichen. Diesen Rollback vor Augen scheut der Stilist das Grobe nicht: „Wenn die nunmehr sich selbst überlassenen Sorgenkinder mit Fleischermessern durch die Schlafzimmer der Zyniker gehen, werden sie die Wahrheit wissen! Labt euch schon jetzt an ihrem Jammer!“
Das tun wir gern, aber fragen uns doch, wie nach dem Abend der Arbeitsgesellschaft ein schöner Morgen aussehen könnte, dessen Mittag nicht blutig ist. Gemach, Gemach, sagt der Kultursoziologe. Wissen wir eigentlich, wovon wir sprechen, wenn wir von Arbeit reden? Ist es nur das Offensichtliche, mit dem wir es zu tun haben? Etwa die Beschäftigungskrise in der Bundesrepublik, die mit offiziell 5,22 Millionen Arbeitslosen ein Ausmaß ereicht, das in der Vorgeschichte dunkler Zeiten erinnert oder die Verschrottung ganzer Regionen irgendwo in der Welt, die sich mit Hungerlöhnen andienen und trotzdem dem vagabundierenden Kapital nicht gefallen?
Wer das Megaproblem Arbeit nur als quantitativen Mangel benennen kann, wird scheitern, wird immer wieder dort eine Antwort suchen, wo sie nicht zu finden ist, bei der Wachstumsmaschine, die nicht mehr hinreichend zu ölen ist, oder bei der Umverteilung, die weder den heutigen noch den künftigen Produktivitätsschüben gewachsen ist – so lautet Englers erste These. Warum nicht diese alten Pfade verlassen und im Jenseits nach einer Lösung suchen, im Jenseits der Arbeit, also in der Nicht-Arbeit, im Leben, das sich leben lässt? Dass diese dritte Variante kaum gesehen wird, muss doch Gründe haben, vermutet Engler: „Die Vergottung einer Arbeit, in der kein Gott mehr wohnt, entspringt der Angst, der Leere ins Auge zu sehen. Es ist das Gespenst des Nihilismus, das die Befreiung von der Arbeit hintertreibt. Was dem Aufbruch in ein Leben ohne Arbeit fehlt, ist mehr als alles andere die Antwort auf die Frage nach dem WOZU.“
Wozu also? Engler befragt die alten Meister, von Charles Fourier bis Karl Marx, begutachtet Paul Lafargues Recht auf Faulheit und Max Webers Protestantische Ethik, zitiert Günther Anders und Hannah Arendt, folgt den Gedankengängen von André Gorz und lässt alte Debatten vorübergleiten, über die gute, sinnvolle Arbeit, die zu fördern wäre, über Verwirklichung in der Arbeit und Befreiung von ihr. Am Ende dieser langen Passagen, die das erste Drittel des Buches füllen, wartet man ungeduldig auf den Ausgang aus dem Labyrinth. Engler, so scheint es, hat die Annäherung an sein Credo bewusst gedehnt, um den Leser die Last der Vergangenheit spüren zu lassen: Nur wer erkennt, wie schwierig es ist, Bürger und Arbeit getrennt zu denken, wird den Epochenbruch würdigen, der mit einem Bürgergeld heraufziehen würde. Nur wer fähig ist, das „wozu“ auf das Leben statt allein auf die Arbeit zu beziehen, wird vielleicht den Irrgarten verlassen.
Bürger sein, bleiben, überhaupt erst werden – selbst dann und vielleicht gerade dann, wenn das bisherige Definitionskriterium des modernen Menschen, die Arbeit, fehlt – wir sind beim eigentlichen Thema angekommen und gespannt, wie der „Schlüssel zum unangefochtenen Leben“ wohl aussehen könnte. Nach kurzem Bedauern über 20, 30 verschenkte Jahre, die angesichts anschwellender Arbeitslosigkeit längst hätten genutzt werden können, erfahren wir zunächst, was nicht gemeint ist.
Die bunte Schar staatlicher Hilfsprogramme durch ein einziges ersetzen, das Soziale zu ökonomisieren, ist Englers Anliegen nicht. Er will keine Löcher stopfen, keine Bedarfsprüfung und keine Gegenleistung, kein offenes oder verdecktes Verharren in den Begriffen von Schuld und Forderung, sondern die Not zur Freiheit wenden. Wenn heute schon Millionen aus dem Erwerbsleben gerissen werden und morgen noch viel mehr, warum dann nicht das gekappte Band zwischen Bürger und Arbeit zum Programm erheben? Weshalb nicht schon jetzt ein Lebensrecht konstituieren, das jedem Mitglied der Gesellschaft, bedingungslos und frei von Arbeitspflicht, ein Grundeinkommen gewährt? Denn irgendwann, wenn das Kapital die ganze Welt nach seinem Bild gezeichnet hat, „stirbt, inmitten überbordenden Reichtums, der Akkumulationstrieb entweder den Nachfragetod, oder das Kapital erholt sich von dem Schock und stattet die Bataillone der Überflüssigen und Minderlöhner mit Anteilsscheinen auf den Reichtum aus.“
Irgendwann wird die Kehrtwende kommen müssen, aber wer sie befördern will, darf nicht nur ein neues Recht mit Verfassungsrang proklamieren. Wie würde es die bestehenden Steuer- und Sozialsysteme revolutionieren? Mit welchen Folgen für Arbeitsplätze und Lohngefüge wäre zu rechnen? Kann die Wirtschaft privatrechtlich organisiert bleiben, wenn ihr der Zahn des Existenzkampfes gezogen ist? Ist Bürgergeld im nationalen Alleingang denkbar? Engler scheut die Details und verpasst damit die Chance, in aktuelle Debatten einzugreifen. Wenn Sozialdemokraten und Grüne, die vor wenigen Jahren noch zaghaft über zivilisierte Haltelinien nachdachten, heute nur noch den Salto rückwärts kennen und die Überzähligen ins Lager der Arbeitsgesellschaft zwingen, dann sollte der Sprung nach vorn nicht nur ein leidenschaftlicher Appell bleiben. „Wo ist der Gegenplan?“ Die Frage wird gestellt, nur die genauere Markierung des Reiches, in dem das Nadelöhr Erwerbsarbeit seine Gültigkeit verloren hat, suchen wir in Englers Buch bis zum Schluss vergebens.
Krise der Arbeit, Krise der Arbeitsgesellschaft – diese fast schon verblichenen Formeln sind aktueller denn je, aber Wolfgang Engler weigert sich, auf dem vorhandenen Resonanzboden zu trommeln. Aufgetaucht aus den Tiefen der politischen Philosophie nähert er sich der Gegenwart, nennt ein Stichwort, um danach sofort wieder hinabzugleiten zu Aristophanes oder zu Edmund Burkes Reflektionen über die Revolution in Frankreich. Dieses kreisende Verfahren, wiederholt in mehreren Anläufen, mag für Ideenhistoriker seinen eigenen Reiz haben. Aber die „radikale Neugestaltung der Gesellschaft“, die Vision für die Zukunft, die im Untertitel versprochen wird, verharrt – allen wunderbaren Pirouetten zum Trotz – bei einem einzigen Begriff.
Damit allein wird der Sturm auf die Travaille, die Relativierung von Lohn und Gehalt als Voraussetzung des Bürgerseins, nicht gelingen. Hohn und Spott für die Polithandwerker, die ständig nach neuen Instrumenten im Baukasten der Gesetze suchen – wer möchte da widersprechen? Die globale Verunsicherung allerdings, die in diesem hilflosen Hantieren zum Ausdruck kommt, ist mit einer Erweiterung des Grundrechtskatalogs, so dramatisch sie auch sein mag, noch längst nicht erledigt.
Wer zum Kern vordringen will, der die Moderne offensichtlich nicht mehr zusammen hält, muss von Arbeit sprechen, aber auch von ihrem Gegenpol, der manchem Volksvertreter die Feder führt. Soll hier, bei der Freiheit des Kapitalverkehrs, bei der Macht der Großunternehmen, bei der Konkurrenz der Währungen, alles unverändert bleiben? Und wie passen, so könnte man weiter bohren, die demografische Zeitenwende und der ökologische turnaround in Englers reformatorisches Werk? Der Soziologe schweigt. Er hat sich in seine Sprache verliebt und die Empirie vergessen.
Wolfgang Engler: Bürger, ohne Arbeit. Für eine radikale Neugestaltung der Gesellschaft. Aufbau, Berlin 2005, 416 S., 19,90 EUR