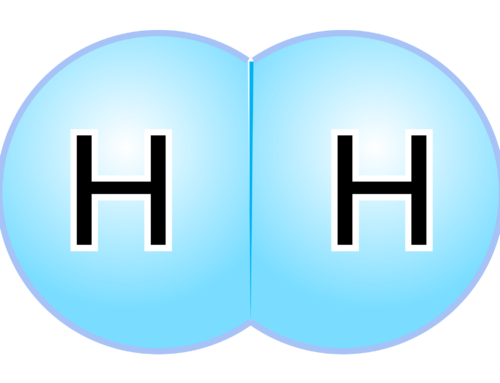Kommentar: Absurde, scheinheilige und verlogene Elite-Debatte
„Ein erhellendes, schlüssig argumentiertes Papier, mit dem ich zu 90 Prozent nicht übereinstimme.“ An diese abschließende Bewertung meiner Seminararbeit erinnere ich mich, nach 20 Jahren, noch genau. Trotz Dissens gab´s „Straight A“, eine glatte 1 von Professor Peter Evans. Unter amerikanischen Soziologen eher ein Radikaler und mit seiner Verachtung von Äußerlichkeiten – ständig hing ihm das Hemd aus der Hose – eher der Typ eines europäischen Intellektuellen, war er doch voll und ganz seiner ehrwürdigen Institution verpflichtet. Der Geist muss frei sein, nur die Leistung darf in seinem Reich zählen. Und wer sich müht, wird vom akademischen Lehrer mit grenzenloser Aufmerksamkeit bedacht.
Nach sechs Jahren Chaos an der Goethe-Uni in Frankfurt und an der FU in Berlin, abgeschlossen mit einer Diplomarbeit, die mein Betreuer kaum gelesen hatte, war das eine postgraduale Jahr an der Brown University für mich eine wunderbare Erfahrung. Obwohl nicht so bekannt wie die anderen „Ivy League“-Universitäten Harvard, Yale oder Princeton, bot auch Brown ein akademisches Paradies: Seminare mit maximal 15 Studenten, freier Zugang zu den Professoren, für jeden „graduate student“ einen eigenen Schlüssel zum Institut, auf dem Campus beinahe täglich Veranstaltungen mit Koryphäen aus anderen Disziplinen. Dazu ein hartes Programm: Jede Woche mehrere Bücher und etliche Aufsätze als Pflichtlektüre, am Ende des Semesters dann noch in allen vier Kursen, die ich besuchte, jeweils eine 20-seitige Seminararbeit. Trotzdem blieb Zeit für Feten der besonderen Art, zu Hause bei den Dozenten und nicht selten nachts im Keller des soziologischen Instituts. Den Preis dieser Freiheit zahlten natürlich andere – jene, die mit ihren Studiengebühren von 18.000 Dollar auch mein Stipendium finanzierten.
Angesichts solcher außerirdischen Dimensionen scheint sich jede ernsthafte Auseinandersetzung über amerikanische Spitzenuniversitäten von vornherein zu verbieten. Absurd, scheinheilig und verlogen ist die aktuelle Debatte über Eliten, über Harvard und Stanford, in der Tat. Sie dient offenkundig dem Zweck, auch für den Hochschulbereich einen Systemwechsel vorzubereiten. Nachdem mit einer katastrophalen Steuerpolitik die öffentlichen Kassen geplündert worden sind, soll privates Geld die Lücken schließen. Von jedem, der sich zur Bildungspolitik äußert, sollte man deshalb ein unmissverständliches „Ceterum Censeo“ fordern: „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass unsere Hochschuletats verdoppelt werden müssen.“ Jenseits der Geldfrage aber kann man von den besten US-Universitäten durchaus lernen. Akademische Freiheit heißt nicht, jedes beliebige Steckenpferd reiten zu dürfen und die Lehre den Mitarbeitern und Tutoren zu überlassen – das ist die Botschaft an die Professoren. Spaß an der Leistung und kollegialer Wettbewerb sind beim Studium unverzichtbar – das sollten die Studierenden wieder lernen.